Der HCG-Philo-Preis 2022/23
Die Gewinner*innen und ihre Essays

KLIMA KRISE WANDEL
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema „Die Klimakrise“,
so lautete die Aufgabenstellung für den 12. HCG-Philo-Wettbewerb (2022/23).
76 Schüler:innen haben sich mit dem Thema beschäftigt und einen Essay zum Thema eingereicht. Die Philosophie-Lehrer:innen des Hans-Carossa-Gymnasiums haben sie sich alle angesehen und drei Essays als besonders gelungen prämiert.
Die Gewinnerinnen und ihre Essays
1. Preis
Wir können in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen
Lara Kazak (2. Semester)
2.Preis
Der Hauptgrund für mangelnde Klimaschutzmaßnahmen ist und bleibt die Trägheit der Masse
Felipe Marien (2. Semester)
3.Preis
Als Menschen haben wir eine enge Beziehung zur Natur und sind von ihr abhängig
Sonja Hildermann (2. Semester)
1. Preis
Lara Kazak (2. Semester)
Sind wir zu klein für das große Ganze?

Abstract: Wie ist der notwendige Klimaschutz ethisch zu begründen? Kant, Bentham und Jonas zufolge sei jeder Einzelne dafür verantwortlich, Egoismus, Faulheit und Selbstgefälligkeit zu überwinden, um nachfolgenden Generationen eine lebenswürdige Welt zu hinterlassen. Letztlich liege die Lösung der Klimakrise in einem moralischen Verhältnis zu Natur und Umwelt: Diese nicht mehr nur als Ressourcen-Lager, sondern immer auch „als Orte der lebendigen Interaktionen“ zu behandeln.
In jüngster Zeit fallen in unserem sozialen und politischen Umfeld immer häufiger Begrifflichkeiten wie selbstverschuldeter Klimawandel, Klimaschutz und globale Klimakrise. Doch wie können wir uns der sich offenbar anbahnenden Klimakatastrophe als einzelne Individuen einer so komplexen Gesellschaft, die in ihrem Verhalten in erster Linie vom Kapitalismus gesteuert zu sein scheint, erfolgreich und effizient entgegenstellen? Sind wir zu klein für das große Ganze? Sind unsere Sinne von Egoismus und Habgier so sehr getrübt, dass wir nicht mehr in der Lage sind, unsere Denk- und Lebensweise zu ändern oder zumindest zu hinterfragen? Haben wir im Sinne Immanuel Kants verlernt, vernünftig zu handeln und zu denken? Und dies, obwohl die Klimakrise eines der drängendsten Probleme unserer Gesellschaft und der uns folgenden Generationen ist? Zweifellos stellt uns der Klimawandel vor eine große Herausforderung in Bezug auf die moralische Verantwortung und Verpflichtung eines jeden Individuums und unserer Gesellschaft als Ganzes.
Eine angemessene Einschätzung der Bedeutung der Termini Klima bzw. Klimaschutz in Bezug auf Begriffe wie Natur, Evolution und Schöpfung, die sich in der Geschichte des westlichen Denkens etabliert haben, ergibt sich ausgehend von der konkreten Situation der heutigen Zeit fraglos als eine sehr schwierige Aufgabe. Der hier folgenden philosophischen Reflexion liegt die Annahme zugrunde, dass der anthropogene Einfluss auf den Klimawandel deutlich feststellbar1 und daher auch ethisch relevant ist. Hierbei ist es von großer Wichtigkeit sowie Bedeutung sich selbst zu vergegenwärtigen, dass sich die Natur und unsere Umwelt zurzeit in einem zu eskalieren drohenden Zustand befinden, über den sich jedes Individuum bewusst werden sollte.
Welche ethischen und philosophischen Werte können das erstrebenswerte individuelle und politische Ziel „Klimaschutz“ begründen? Welche klimaethischen Maßnahmen sind im Interesse aller im Spannungsfeld „Klimaschutz und Rechts- und Freiheitseinschränkungen für den Einzelnen“ zu vertreten? Sind wir überhaupt moralisch verantwortlich für den Klimaschutz?
|

Als eine der wichtigsten ethischen Theorien ist hier die Ethik nach Immanuel Kant anzubringen, die auf der Idee der Moralphilosophie basiert.2 Im ersten Abschnitt der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, die als Konzeption einer reinen Moralphilosophie a priori angesehen werden kann, gibt Kant eine Vorstellung davon, wodurch eine Handlung einen moralischen Wert erlangt. Moralisch wertvoll ist nach Kant im Sinne eines „Handelns aus Pflicht“ eine Handlung, sofern diese rein aus der Pflicht heraus ausgeführt werde. Dabei dürfe den Handelnden nichts weiter zu dieser Handlung motivieren als die Pflicht selbst, nämlich die Achtung vor der jedem Menschen innewohnenden moralischen Sitte. Kant würde anführen, dass moralisches Handeln auf universellen moralischen Gesetzen basiert, die für alle Menschen gelten. Diese moralischen Gesetze sind rational und können durch Vernunft und moralische Überlegung erkannt werden. Im Kontext des Klimaschutzes kann man argumentieren, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, die Auswirkungen unseres Handelns auf das Klima zu minimieren und eine nachhaltige Zukunft für uns und kommende Generationen zu schaffen. Dies kann als universelles moralisches Gesetz betrachtet werden, das auf Vernunft und moralischer Überlegung basiert. Kant betonte auch die Bedeutung von Pflicht und Verantwortung. Im Kontext des Klimaschutzes bedeutet dies, dass jeder Einzelne für seine Handlungen und deren Auswirkungen auf das Klima verantwortlich ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kantianische Ansatz zum Klimaschutz uns dazu auffordert, moralische Überlegungen in unsere Entscheidungen einzubeziehen und uns für unsere Handlungen und deren Auswirkungen auf das Klima verantwortlich zu fühlen. Durch eine solche Philosophie können wir ein besseres Verständnis für die moralischen Implikationen unseres Handelns im Kontext des Klimawandels entwickeln und bessere Lösungen für diese drängende Herausforderung.
Immanuel Kant wäre der Auffassung, dass wir nur auf der Grundlage seiner Rechts- und Morallehre zu gerechten Klimaregelungen gelangen können.
Aus Kants Perspektive wäre es mithin als moralisch verwerflich zu erachten, unsere Umwelt, in der wir leben durch unsere egoistischen und selbstgefälligen Handlungen zu zerstören und den Klimawandel und eine damit einhergehende Klimakrise zugunsten unserer wirtschaftlichen und anderen individuellen Interessen anzusteuern bzw. zumindest bewusst in Kauf zu nehmen. Daher liegt es in der Verantwortung eines jeden Individuums, Maßnahmen zur Prävention des Klimawandels zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass zukünftige Generationen eine lebenswertere Umwelt vorfinden. Doch was genau versteht man eigentlich unter Verantwortung? Was verstehen wir unter Schuld im Zusammenhang mit der Klimakrise? Und wie genau lassen sich diese Begrifflichkeiten voneinander trennen? Beiden Begriffen ist immanent, dass das Individuum selbst in der Lage ist, frei über seine Handlungen zu bestimmen. In erster Linie versteht man unter dem Begriff Verantwortung das „Rechenschaft geben“ für ein bestimmtes Handeln oder für dessen Folgen. Die Verantwortung wird übernommen und man ist verpflichtet, die Konsequenzen, welche nicht immer negativ sein müssen, für sein Handeln zu tragen.3 Die moralische Schuld hingegen wird einem Individuum zugewiesen. Jemand der moralisch schuldig ist, verstößt bei einer Handlung bewusst und nach freier Entscheidung gegen Normen. Die Verantwortung kann hierbei allerdings der oder dem Schuldigen zugewiesen werden.
|
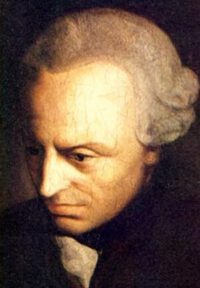
Die Frage, ob nun jedem einzelnen Individuum die Schuldfrage betreffend des Klimawandels zugewiesen werden kann, ist nicht leicht zu beantworten. Allerdings kann jedem Einzelnen eine moralische Verantwortung zugeschrieben werden. Wir müssen die Folgen unserer selbstgefälligen Handlungen und Lebens- und Denkweise tragen und sind verantwortlich für den unglücklichen Zustand, in dem sich unsere Umwelt befindet sowie der Besserung dieser.
Auch könnten die Prinzipien des klassischen Utilitarismus, der auf Jeremy Bentham4 zurückgeht, herangezogen werden, um unsere moralische Verpflichtung zu klimaethischem Handeln zu begründen. Nach Ansicht der Utilitaristen sollen soziale Institutionen und öffentliche Gesetze sowie Handlungen so gestaltet sein, dass sie den Gesamtnutzen oder das Wohlergehen jedes Einzelnen in der Gesellschaft maximieren, wobei das gleiche Gewicht auf das Wohlergehen jedes einzelnen Menschen gelegt wird. Demnach sind diejenigen Handlungen moralisch richtig, deren Folgen (Konsequenz-Prinzip) für das Glück (hedonistisches Prinzip) aller Betroffenen (Universalitätsprinzip) nützlich sind (Utilitaritätsprinzip). Im Kontext des Klimaschutzes kann man argumentieren, dass Klimaschutzmaßnahmen notwendig sind, um das Wohl der gegenwärtigen und künftigen Generation, also aller Betroffenen, zu fördern und zu sichern, ohne unseren persönlichen Bedürfnissen besonderes Gewicht zu verleihen. Hieran wird das Spannungsfeld zwischen nötigem Klimaschutz und individuellem Freiheitsbedürfnis besonders deutlich.
Ein anderer Ansatz wäre die Frage nach der intergenerationellen Gerechtigkeit, in der es um die Frage der Verpflichtungen gegenwärtiger Generationen gegenüber der ihnen nachfolgenden Generationen geht. Danach ergäbe sich die Notwendigkeit des Klimaschutzes daraus, dass der Nutzen der Treibhausgasemissionen der gegenwärtig lebenden Generation zugutekommt, während die Lasten bzw. die negativen Folgen des Klimawandels die ihnen nachfolgenden Generationen tragen müssen.
Eine nachhaltige und effiziente Politik des Klimaschutzes sollte nicht auf praktischen Zielen fußen, deren Gründe und Motivationen mit gängigen Voraussetzungen der Moderne bzw. der modernen westlichen Kultur zusammenhängen, sondern die Ziele verlangen eine In-Frage-Stellung der Weltanschauung, ausgehend von welcher die wichtigsten kulturellen Errungenschaften der Moderne entstanden sind.
Gewiss wäre es schwierig, als Vorschlag für eine Änderung der gegenwärtigen Klimakrise den Rückgang auf irgendeine Form von Weltkonfiguration zu fordern, in denen all die Errungenschaften der Moderne aus der Vergangenheit keine Rolle mehr spielen, ein System, in dem wir vollends Verzicht üben müssten.
Um diesem Teufelskreis zu entkommen, müssen wir uns und den uns nachfolgenden Generationen in einer Art ethischen Selbstreflexion vor Augen führen, dass wir in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen können und der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, vor diesem Hintergrund durchaus zu hinterfragen ist, durch jeden Einzelnen, vor allem aber durch die Industriestaaten. Wir können nicht länger ignorieren, dass wir nur einen Planeten Erde haben.
|
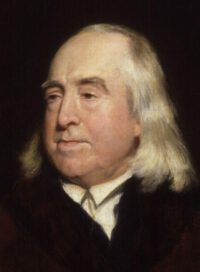
Viele Klimaaktivisten sind längst überzeugt, dass die Natur nur überleben kann, wenn der Kapitalismus endet. Also propagieren sie den eingängigen Slogan: »system change, not climate change«. Doch ist es wirklich so einfach, diesen Wandel zu vollziehen und was wäre der Einzelne letztendlich tatsächlich bereit, zu opfern? Lässt sich der Einzelne, die Gesellschaft als Ganzes, lassen sich am Ende ganze Industrienationen davon überzeugen, dem Klimaschutz vor anderen (wirtschaftlichen) Interessen den Vorzug zu geben?
Wie sähe es mit dem sozialen Frieden aus, wenn der Einzelne gezwungen wäre, auf individuelle Freiheiten zu verzichten? Ein nachhaltiger und gerechter Klimaschutz wird sich diesen Fragen stellen und diesen gerecht werden müssen, wollen wir unsere Demokratie nicht in Frage stellen. Denn es gilt nicht nur, den Klimawandel mit allen Mitteln auf Kosten des Zusammenhalts der Gesellschaft zu bekämpfen, sondern auch, den sozialen Frieden zu wahren.
Demnach müssten die Grenzen der individuellen Freiheit eines jeden Individuums künftig immer wieder erneut ausgehandelt werden, damit kein Spannungsgefälle zwischen dem Bedürfnis der persönlichen Freiheit und den Maßnahmen des Klimaschutzes entsteht und sich kein Individuum in seiner Freiheit verletzt fühlt.
Denn die persönliche Freiheit eines Einzelnen hört dort auf, wo die Freiheit eines anderen Individuums endet. Der kategorische Imperativ des Philosophen Immanuel Kants weist hierbei auch auf das Grundprinzip eines friedlichen, harmonischen sowie menschlichen Miteinanders hin, der da besagt: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“
Doch wie könnte ein künftiges System aussehen?
Eine Lösung im Grundproblem des Klimaschutzes könnte jedoch darin bestehen, den Übergang von einem unmoralischen Verhalten (nämlich der Fortsetzung einer maßlosen industriellen Entwicklung) zu einer ethischen Einstellung zur Natur (durch das Abzielen auf ein gemäßigtes Wachstum und die damit verbundene Reduzierung der Folgen unseres Lebenswandels für unsere Umwelt) mittels einer neuen Konzeption der Ethik und Moral zu vollziehen, in der Akzeptanz zur Reflexionsfähigkeit und diese letztendlich zur Einsicht führt. In dieser neuen Konzeption wäre Ethos als neue Sitte zu verstehen, d. h. als die Öffnung eines neuen Horizonts der Reflexion, in der unsere Natur und Umgebung nicht mehr als Extension von Ressourcen behandelt, sondern als Orte der lebendigen Interaktionen betrachtet werden, in denen das zu Schützende kein Objekt ist, sondern ein Konglomerat von Beziehungen, die nicht getrennt von unserem eigenen (Über-)Leben angenommen werden können. Diesem neuen Ethos ist der Begriff „Klimakatastrophe“ nicht als äußere Schranke, sondern vielmehr völlig inhärent, denn Katastrophe bedeutet „Umwendung“ oder „Drehung“ und bezieht sich in diesem Fall auf die Umwendung im Verhalten des Menschen gegenüber unserem Planeten und umgekehrt.
Schließlich hängen wir von unserer Umwelt und Natur genauso ab, wie sie auf unsere Schutzhandlungen angewiesen ist.
2.Preis
Felipe Marien (2. Semester)
Klimakrise: „Nicht mein Problem!“
Abstract: Klimakrise und Klimaschutzmaßnahmen schränken die menschliche Handlungsfreiheit ein. Des Autors These hierzu lautet: „Je weniger Freiheitseinschränkungen heute, desto mehr Freiheitseinschränkungen ergeben sich morgen.“ Gleichzeitig gehen Klimawandel wie Klimaschutz mit drei elementaren Ängsten einher: Veränderungsangst, Überforderungsangst und Kontrollverlust-Angst. Um die „Klima-Ungerechtigkeiten“ gegenüber Folge-Generationen zu verkleinern, „muss die Ohnmacht des Einzelnen überwunden werden, damit die Macht der Gemeinschaft etwas verändern kann.“

Ca. 70 Aktivist*Innen der Initiative „CancelLEJ“ blockieren in der Nacht vom 09.07. auf 10.07. eine LKW Zufahrt des DHL-Terminals am Flughafen Leipzig/Halle. Sie wollen damit gegen den geplanten Ausbau des Flughafens und gegen die Zunahme des Luftverkehrs demonstrieren. Bild: Blockade mit Transparenten: Nachts gut schlafen statt Frachflughafen.
„Man kann nicht allen helfen, sagt der Engherzige, und hilft keinem.“ – Dies sagte die ca. 100 Jahre nach Immanuel Kant geborene Schriftstellerin Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach. Dieses durchaus provokante Zitat weist auf die Möglichkeit des Menschen hin, selbstverantwortlich Entscheidungen treffen zu können. Gleichzeitig spiegelt es die Haltung vieler Menschen zu dem aktuell wichtigsten und schwierigsten Problem der Menschheit, der Klimakrise, wider. Aber sind Sichtweisen und Mottos wie: „Die anderen tun ja auch nichts!“ und „Ich habe sowieso keinen Einfluss auf das Gesamtgeschehen!“ gerechtfertigt? Klar ist, sie sind keineswegs ein Lösungsansatz für die Klimakrise.
An diesem Beispiel wird deutlich: der Klimawandel hat viele philosophische Facetten.
In meinen folgenden Ausführungen versuche ich, die philosophischen Fragen, die sich unweigerlich stellen, aufzuzeigen, herauszuarbeiten und genauer zu beleuchten.
Dabei gehe ich zuerst auf die Verantwortung des Individuums ein, daraufhin beleuchte ich die Verbindung der Klimakrise zum Begriff der Freiheit. Dies hat mich dann zum Thema Gerechtigkeit in der Klimakrise geführt. Zum Schluss werde ich im Detail auf die Ängste eingehen, die der drohende Klimawandel einerseits und ein verschärfter Klimaschutz anderseits hervorrufen.
Zunächst stellt sich für mich die große Frage: Welche Rolle spielt das Individuum bei dieser globalen Herausforderung? Um diese Frage zu beantworten, sollte man sich klar machen, dass die Klimakrise als ein Ergebnis oder als die Summe des gemeinsamen Handels aller Individuen gesehen werden kann. Gegenwärtig bedeutet dies, dass die Menschheit nur als Gesamtes diese drohende Katastrophe abmildern kann, um die Lebensgrundlage der zukünftigen Generationen zu sichern. Man kann von einer Ohnmacht des Einzelnen und einer Macht der Gemeinschaft sprechen. Doch wann fühlt sich das Individuum verantwortlich oder kann es überhaupt zur Verantwortung gezogen werden?
Momentan beobachte ich bei vielen Trägheit, manchmal sogar Gleichgültigkeit. Der Einfluss des Einzelnen auf die Gesamtsituation wird als sehr gering eingeschätzt: „Da kann ich doch nichts machen!“ Dies widerspricht aber der Entstehung der Klimakrise, die als ausschließlich menschengemachte Katastrophe zu sehen ist. Jedes Individuum ist also verantwortlich; auch verantwortlich für die Menschen, die bereits unter der Katastrophe leiden. Doch diese Einstellung vertreten eigentlich nur die, die bereits aktiv etwas gegen den Klimawandel unternehmen, weshalb sich folgende Fragen aufwerfen: Wann ergreift der Mensch Selbstinitiative und wodurch verändert er sein Verhalten – durch Erkenntnis oder durch Erfahrung?
Seit mindestens 50 Jahren warnt die Wissenschaft vor dem eintretenden Klimawandel und trotzdem reicht diese Erkenntnis nicht aus, um eine notwendige Veränderung unserer Gesellschaft und unseres Lebensstandards herbeizuführen. Für mich ist also klar, die Menschheit als Gesamtes verändert sich (hinsichtlich des Klimawandels) nicht durch Erkenntnis, sondern durch Erfahrungen, welche bei dieser globalen Katastrophe eigentlich nur leidvoll sein können. Ob die Menschen wirklich erst handeln, wenn sie unmittelbar den Folgen des Klimawandels ausgesetzt sind? Jedenfalls können wir dies bei uns in Europa noch nicht beobachten, denn hier sind die Folgen der Krise noch nicht so stark spürbar. Anderswo hingegen leiden Menschen bereits aufgrund von Überschwemmungen, Ansteigen des Meeresspiegels, Dürren, Wassermangel, etc. Und für dieses Leiden sind wir, hier in Europa, besonders verantwortlich, denn die Verursacher der Emissionen über die letzten Jahrhunderte sind fast ausschließlich Industrienationen. Im Gegensatz dazu sind die ärmeren Länder gerade die, die besonders unter den Folgen leiden. Zudem sind die Industrieländer die, die nun den Menschen in Schwellenländern den hohen Lebensstandard verwehren, mit der Begründung, dass diese sonst zu viele Treibhausgase emittieren würden, während hierzulande ein enorm hoher Lebensstandard herrscht. Philosophisch betrachtet ist dies zutiefst unmoralisch, denn es ist eindeutig nicht mit unser Wertevorstellung vereinbar (z.B. Gerechtigkeit, Verantwortung) und demnach „falsch“. Bereits Kant sagte: „Je eigennütziger der Beweggrund, desto weniger Moralität“. Dies bestätigt sich hier ziemlich eindeutig. Das Verhalten der Industrieländer gegenüber den Schwellen- und Entwicklungsländern kann auf jeden Fall als eigennützig erkannt werden und wie bereits gesagt auch als sehr unmoralisch. Ich denke viele Menschen erkennen jedoch die philosophische und moralische Dimension des Klimaschutzes nicht, weshalb ich die meines Erachtens rhetorische Frage stelle: Müsste Nachhaltigkeit nicht als ein moralisches Ziel integriert werden?
Nun möchte ich eine ganz andere philosophische Facette der Krise beleuchten:
Bedroht die Klimakrise die Freiheit? Oder bedroht der Klimaschutz die Freiheit?
Zunächst müssen wir dafür klären, was hier unter Freiheit zu verstehen ist. So betrachte ich Freiheit im Sinne Immanuel Kants, also als einen moralischen Begriff. Er definiert eine „innere“ Freiheit, also die Freiheit des Individuums, unabhängig von anderen und von eigenen Gelüsten zu entscheiden. Kant sieht die Freiheit als zwingende Voraussetzung für moralisches Handeln. So nimmt er an, dass erst ein freies Wesen zwischen Gut und Böse wählen und somit moralische Verantwortung übernehmen kann. Nach dieser Definition schränkt weder die Klimakrise noch der Klimaschutz die Freiheit im philosophischen Sinne ein, denn die aus Klimakrise und Klimaschutz resultierenden Folgen gefährden nicht den Willen des Menschen, frei seine Entscheidungen treffen zu können.
Die Freiheit kann also auch als „äußere“ Freiheit verstanden werden; im Sinne einer Handlungsfreiheit. Ihr zufolge ist der Mensch frei von jeglichen Zwängen und daher wesentlicher Verursacher seiner Entscheidungen. Diese Freiheit ist eindeutig durch die Klimakrise bedroht, zum Beispiel ist der Mensch nicht mehr frei, wenn er aus seiner Heimat fliehen muss, weil Überschwemmungen drohen, das Ackerland unfruchtbar geworden ist oder kein Trinkwasser mehr zur Verfügung steht etc.
Umgekehrt sehen sich viele ausgerechnet durch Klimaschutzmaßnahmen in ihrer „äußeren“ Freiheit bedroht. So empfinden einige z.B. das diskutierte Tempolimit oder verschärfte Emissionsgrenzwerte als Freiheitseinschränkungen.
Die Handlungsfreiheit des Menschen wird also durch die Klimakrise und durch Klimaschutzmaßnahmen eingeschränkt.
Bisher habe ich bewusst die nächste Generation und das Thema Generationsgerechtigkeit ausgelassen, doch ich merke, dass man bei der philosophischen Betrachtung der Klimakrise und gerade bei dem Themenblock Freiheit schwer ohne die Auseinandersetzung mit diesem Begriff auskommt. Denn während man über Freiheitseinschränkungen der Menschen heute spricht, sollte man sich auch um Freiheitseinschränkungen der nächsten Generationen Gedanken machen. Meine These hierzu lautet: Je weniger Freiheitseinschränkungen heute, desto mehr Freiheitseinschränkungen ergeben sich morgen. Genau hier geht es um Gerechtigkeit zwischen den Generationen und um ein moralisches Gleichgewicht: Wie viele Freiheiten kann man heute noch zulassen? Wie viel Handlungsspielraum bleibt der nächsten Generation? Ein fast unlösbarer Konflikt, denn es scheint unvermeidbar, dass die nächste Generation weniger „äußere“ Freiheiten hat, als die Menschen heute sie noch haben. Dies liegt daran, dass der Klimawandel und seine Folgen sich deutlich verschärfen und beschleunigen werden. Die nächste Generation wird zwingend mit stärkeren Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert sein, als wir es heute sind, denn die heutige Generation hat noch nicht die eigentlich erforderlichen Maßnahmen und Instrumente entwickelt, um die Verschärfung des Klimawandels zu verhindern. Vor diesem Hintergrund scheint eine Generationsgerechtigkeit im strengen Sinne gar nicht möglich. Wir können die „Ungerechtigkeit“ nur abmildern, indem wir die Verschärfungen der Auswirkungen durch erhöhte Anstrengungen zum Klimaschutz verringern.
Zweifelslos erzeugt der Klimawandel einen enormen Handlungsdruck; auch radikale Forderungen werden erhoben, die jedoch emotionale Abwehrreaktionen auslösen.
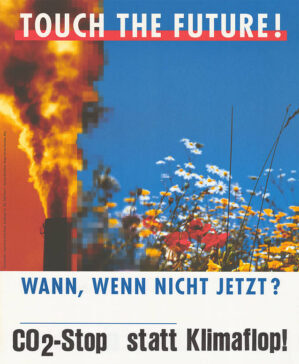
Immer wieder fallen Worte wie: „Ökodiktatur“ oder „Klimaterrorismus“; Diktatur und Terrorismus sind Begriffe die mit Zwang und Gewalt verbunden werden.
Diese Worte deuten auf tiefe Ängste des Menschen hin, die der Klimaschutz in seinen Ausführungen hervorruft. Strikte Klimaschutzmaßnahmen könnten Lebensmittel verteuern, den Konsum einschränken sowie Tourismus und Freizeitaktivitäten, unter anderem durch Mobilitätseinschränkungen, begrenzen. Dies spiegelt die Angst wider, den hohen Lebensstandard aufgeben zu müssen. Damit geht die Angst vor Komforteinbußen einher, darunter z.B. das tägliche Autofahren zur Schule oder zum Sportverein. Oft bedeutet Klimaschutz mehr Aufwand. Aber viele fürchten sich auch vor dem Verlust des Wohlstands, zum Beispiel mehrmals im Jahr in den Urlaub zu fliegen oder ein Zweitauto zu besitzen. Grundsätzlich haben die Menschen Angst vor jeglichen Arten von Einschränkung, wie die bereits erwähnten Freiheitseinschränkungen durch beispielsweise das Tempolimit. Tiefenpsychologisch gesehen könnte man alle durch den Klimaschutz hervorgerufenen Ängste unter drei sehr tief im Menschen verankerten Ängsten zusammenfassen: Angst vor Veränderung, Angst vor Überforderung und Angst die Kontrolle zu verlieren.
Die Grundängste, die durch die Klimakrise und den Klimawandel beim Einzelnen hervorgerufen werden, sind ziemlich ähnlich zu den drei genannten. Jedoch unterscheiden sie sich in ihrer Herkunft und sind deutlich existentieller. Zuallererst wird die grundlegende Angst vor körperlichem Schaden angesprochen, welche sogar bis hin zu einer Todesangst führen kann, z.B. bei Umweltkatastrophen wie enormer Hitze, Überschwemmungen und Erdrutschen. Wird nicht der Klimawandel sogar bereits von einige als der ultimative Untergang der Menschheit angesehene? Ängste entstehen auch, wenn der Verlust der Lebensgrundlagen droht. Dies kann zum einen den Arbeitsplatz betreffen, z.B. hängen Menschen in verschiedenen Ländern am Skitourismus und sind von diesem abhängig. Zum anderen werden einige Menschen aber auch ihr Haus sowie Grund und Boden verlieren und damit aus ihrer Heimat fliehen müssen. Ebenfalls droht Nahrungsmittelknappheit aufgrund von Dürren, Unfruchtbarkeit oder Versalzung. Die eintretenden klimatischen Veränderungen sind aber auch mit einer Einschränkung der Lebensqualität verbunden. Wenn die Temperatur steigt, wird das Leben nun mal erheblich unangenehmer und anstrengender. Ebenfalls nachvollziehbar ist die Angst vor Konflikten, die aus der Klimakrise resultieren. So drohen bereits heute schon Kriege aufgrund von Wassermangel und Ressourcenknappheit wie zum Beispiel der Konflikt zwischen Äthiopien, dem Sudan und Ägypten um das Wasser des Nil. Abgesehen von Kriegen könnte die Klimakrise aber auch zu sozialen Unruhen führen. Schon seit einigen Jahren gibt es Millionen von „Klimaflüchtlingen“, die durch z.B. den Anstieg des Meeresspiegels oder Dürren ihre Lebensgrundlage verloren haben.
Nach dieser Gegenüberstellung fällt mir auf, dass die Menschen, die vor dem Klimaschutz Angst haben, nicht dieselben Menschen sind wie die, die vor dem Klimawandel Angst haben. In meiner Umgebung erfahre ich, dass die Mehrheit Angst vor dem Klimawandel und nicht vor den Maßnahmen des Klimaschutzes hat. Zum einen kann angenommen werden, dass diese Beobachtung auf die gesamte Gesellschaft übertragen werden kann. Zum anderen könnte dies aber auch an meiner Umgebung liegen, die hauptsächlich aus der jüngeren Generation besteht. Könnte es also sein, dass die jüngeren Menschen eher Angst vor dem Klimawandel, also eine Zukunftsangst, haben und die älteren sich eher Sorgen wegen des Klimaschutzes, mit Auswirkungen auf die Gegenwart, machen? Die kaum eintretenden Veränderungen könnten also mitunter darauf zurückzuführen sein, dass die politischen Entscheider mehrheitlich älteren Generationen angehören. Doch die Schuld ausnahmslos bei der politischen Spitze zu suchen, deute ich nur als einen Versuch die Verantwortung von sich zu schieben, denn der Hauptgrund für mangelnde Klimaschutzmaßnahmen ist und bleibt die Trägheit der Masse.
Nach meiner intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema bin ich zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen. Zuallererst sind insbesondere die Bewohner der Industrienationen für die Klimakatastrophe verantwortlich, denn diese haben in den letzten 175 Jahren den Großteil der Emissionen verursacht. Unser Verhalten gegenüber den ärmeren Ländern ist bei genauerer Betrachtung sehr unmoralisch.
Meine wichtigste Erkenntnis ist also, dass sowohl die Klimakrise als auch der Klimaschutz die Handlungsfreiheit der Menschen einschränken. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit bin ich zu der These gekommen, dass weniger Freiheitseinschränkungen heute, durch mehr Freiheitseinschränkungen morgen „bezahlt“ werden. Demnach ist eine Generationsgerechtigkeit im eigentlichen Sinne gar nicht möglich. Durch die emotionale Betrachtung des Themas ist mir aufgefallen, dass Klimakrise und Klimaschutz drei Grundängste des Menschen hervorrufen: Angst vor Veränderung, Angst vor Überforderung und Angst die Kontrolle zu verlieren. Jedoch unterscheidet sich die Ursache der Ängste bei entsprechend Klimakrise und Klimaschutz.
Zum Abschluss noch meine Wünsche:
Wenn wir die „Ungerechtigkeit“ gegenüber der nächsten Generation verkleinern und die Folgen der Klimakatastrophe reduzieren wollen, muss die Ohnmacht des Einzelnen überwunden werden, damit die Macht der Gemeinschaft etwas verändern kann. Dafür sollte jeder Verantwortung übernehmen, eine Trägheits-Stimmung vermeiden und seine Komfortzone verlassen.
https://www.philosophie.ch/2019-07-16-rehmannsutter
https://www.philosophie.ch/2018-07-30-rehmannsutter
http://www.denkwerkzukunft.de/index.php/aktivitaeten/index/Entwicklung-Nachhaltigkeit#_edn2
https://www.philomag.de/lexikon/freiheit#:~:text=Zun%C3%A4chst%20ist%20sie%20ein%20metaphysischer,auch%20Freiheit%20der%20Indifferenz%20genannt).
3. Preis
Sonja Hildermann (2. Semester)
Klimakrise: Die Bedrohung unserer Zukunft
Abstract: Der notwendige Klimaschutz wird durch die Verstrickungen von Politik, Gesellschaft und Industrie erschwert. Begründungen dafür, den „Konflikt zwischen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und langfristigen ökologischen Zielen“ zugunsten letzterer aufzulösen, können sowohl Physiozentrismus als auch Anthropozentrismus liefern, sofern beide die unauflösbare „Verflechtung zwischen Menschen und Ökosystemen“ betonen. Mögliches Mittel der Politik, Frieden mit der Natur zu erzielen, sei ein Vertrag zwischen Staat und Wirtschaftsunternehmen nach dem Muster des Staatsvertrags von Thomas Hobbes.
![]()
Die Klimakrise ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Durch den menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen, vor allem durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, steigt die Temperatur der Erde und führt zu weitreichenden Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt. Die Auswirkungen der Klimakrise sind vielfältig und umfassen unter anderem den Anstieg des Meeresspiegels, extremere Wetterbedingungen, Dürren, Waldbrände und das Aussterben von Arten. Des Weiteren betreffen sie vor allem Menschen in armen Ländern und Regionen, wie zum Beispiel Küstengebieten, ariden Gebieten und arktischen Regionen. Die Opfer der Klimakrise sind oft Menschen, die am wenigsten zum Problem beigetragen haben, aber am stärksten unter den Folgen leiden müssen, wie zum Beispiel durch den Verlust von Lebensgrundlagen, Vertreibung, Hunger, Krankheiten und Tod. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass es wichtig ist, die Klimakrise aus einer menschlichen Perspektive zu betrachten und Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse und Rechte der Opfer berücksichtigen und unterstützen. Resultierend daraus wird zur Bekämpfung der Klimakrise eine globale Zusammenarbeit und Beteiligung erfordert, um den Ausstoß von Treibhausgasen drastisch zu reduzieren und die bereits verursachten Schäden zu begrenzen, um das Überleben unserer Zivilisation zu sichern.
Die Klimakrise ist ein globales Problem, das die gesamte Menschheit betrifft. Daher ist jeder Einzelne, jedes Land, jedes Unternehmen und jede Regierung für den Klimaschutz verantwortlich, doch gerade diejenigen in einer mächtigen Position missbrauchen in gewissem Maße ihre Macht. Große Unternehmen und ihre wirtschaftlichen Aktivitäten tragen zweifellos zum Klimawandel bei. Doch wer genau kann für die Klimakrise zur Rechenschaft gezogen werden? Es handelt sich um ein stark umstrittenes Thema, bei dem Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten nicht nur die Regierung, sondern auch Unternehmen aufs heftigste kritisieren und beschuldigen, einen großen Anteil an der Klimaerwärmung zu haben. Allerdings lässt sich dagegen argumentieren, dass solange diese Unternehmen die Gesetze ihres Landes einhalten, sie keine Straftat begehen und somit nicht strafrechtlich belangt werden können. Zudem ist es ihr Ziel, möglichst viel Profit zu erzielen. Ferner können Kunden entscheiden, welche Unternehmen sie unterstützen.
Ein weiteres oft genutztes Argument der Unternehmen ist, dass, wenn sie beispielsweise keine fossilen Brennstoffe kaufen, es ein anderes Unternehmen tun wird. Ein Unternehmen wird demnach nur dann auf den Klimaschutz achten, wenn entweder ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt wird oder wenn der Staat die Gesetze zugunsten des Klimas ändert.
Die Regierung vertritt derzeit eine wirtschaftsliberale Position und muss die Funktionsfähigkeit des Marktes garantieren sowie Steuern investieren, obwohl diese wirtschaftliche Aktivität eine Ursache für die Klimaerwärmung ist, deren Kosten jeder trägt. Die Unternehmensbilanz müsste die negativen Umweltauswirkungen berücksichtigen und der Staat müsste festlegen, wer dafür verantwortlich ist, um einen moralischen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Politik ist oft nicht unparteiisch, da Unternehmen häufig in politische Entscheidungen einbezogen werden, was auch vorteilhaft für Politiker ist, aufgrund der wirtschaftlichen Stabilität, die die privatwirtschaftlichen Unternehmen bieten. Wenn die Regierung dennoch eine Entscheidung treffen würde, die Unternehmen zum Klimaschutz zwingt, könnten Unternehmen mit einem Standortwechsel ins Ausland drohen (Regime Shopping). Dies wirft die Frage auf, welchen Nutzen Unternehmen für die Gesellschaft haben.
Zunächst werde ich die Vertragstheorie von Thomas Hobbes allgemein zusammenfassen, bevor ich sie auf meine Überlegung anwende: Die Vertragstheorie von Hobbes geht davon aus, dass die Menschen von Natur aus egoistisch und gewalttätig sind, um ihre Selbsterhaltung zu ermöglichen, da das laut Hobbes das oberste Gebot sei. Diese Sachlage bezeichnet Hobbes als „Naturzustand“. Jedoch führt es dazu, dass ein Krieg resultiert, bei dem alle gegen alle (bellum omnium contra omnes) kämpfen. Um diesem Zustand zu entkommen, müssen die Menschen einen Sozialvertrag abschließen, indem sie ihre individuellen Rechte und somit ihre Freiheit an eine zentrale Autorität abgeben, damit diese Frieden und Sicherheit gewährleistet. Diese Autorität hat die Macht, die Gesellschaft zu regieren und die Einhaltung des Vertrags durchzusetzen. Hobbes betont, dass die Autorität notwendig ist, um eine stabile und friedliche Gesellschaft zu schaffen.
Aktuell herrscht Freiheit, da Unternehmen beispielsweise das tun, was notwendig ist, um zu überleben. Dies entspricht den Gesetzen des Naturzustands. Um jedoch Frieden zu gewährleisten, muss die Freiheit von dem Staat eingeschränkt werden, sowohl von uns als auch von den Unternehmen. Das passiert durch einen Vertrag, der alle Parteien und Betroffenen einschließt. Dieser Vertrag zielt darauf ab, den derzeitigen Naturzustand zu verbessern. Demnach müssten Unternehmen sich an die Vorschriften halten und sich für einen Klimaschutz einsetzten, anstatt aus egoistischen Gründen zur Umweltverschmutzung beizutragen.

Extinction Rebellion färbt die Spree mit Uranin grün, um die Klimakatastrophe sichtbar zu machen. Berlin, 07.09.22
Ein solcher Zustand herrscht nicht bereits, weil es oft einen Konflikt zwischen kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen und langfristigen ökologischen Zielen gibt. Viele Unternehmen und Regierungen haben oft einen begrenzten Horizont und fokussieren sich auf kurzfristige Gewinne, anstatt langfristige Auswirkungen auf die Umwelt und das Zusammenleben zu berücksichtigen. Darüber hinaus gibt es oft eine mangelnde Sensibilisierung und Bildung in der Bevölkerung bezüglich der Bedeutung des Klimaschutzes und der Biodiversität. Es bedarf also eines Umdenkens und einer gemeinsamen Anstrengung, um den erstrebenswerten Zustand zu erreichen.
Bis ins 18. Jahrhundert galt die Natur als etwas „Hässliches“ und „Unmoralisches“, aber im Zeitalter der Romantik wurde sie neu bewertet und mit Freiheit in Verbindung gebracht. Heutzutage verspüren einige eine gewisse Verbundenheit mit der Natur, die aufgrund unserer Herkunft begünstigt wird. Der Naturphilosoph Thomas Kirchhoff erklärt, dass sich unser Blick auf die Natur ständig ändert, da sich unsere Kultur ebenfalls kontinuierlich verändert und weiterentwickelt.
Menschen schreiben der Natur verschiedene Bedeutungen und Werte zu. Sie hat sowohl instrumentelle Werte, indem sie als Nahrungsquelle und/oder Rückhalteraum für Niederschlag dient, als auch nicht-instrumentelle Werte wie das Genießen ihrer Schönheit oder ihre Bedeutung für Freiheit. Diese Werte stellen das Mensch-Natur-Verhältnis dar. Jedoch wird leider von einigen akzeptiert und toleriert, dass die moderne Gesellschaft die Natur ausbeutet, was dringend geändert werden muss. Philosophen stellen sich dabei die Frage, ob der Mensch sich selbst als Teil der Natur betrachten sollte, um die Bedeutung des Naturschutzes stärker zu berücksichtigen. Mit dieser Frage beschäftigen sich der Physiozentrismus und der Anthropozentrismus.
Der Physiozentrismus postuliert, dass die Natur einen unabhängigen und moralischen Eigenwert besitzt, den der Mensch respektieren muss. Im Gegensatz dazu legt der Anthropozentrismus den Fokus ausschließlich auf den Menschen und leugnet jeglichen Eigenwert der außermenschlichen Natur. Kirchhoff argumentiert, dass aus einer physiozentrischen Perspektive kein konkretes Ziel für den Naturschutz ableitbar seien würde, da die Natur ständig im Wandel sei und kein bestimmter Zustand als schützenswert anerkannt werden könnte. Da sich die Natur ständig verändere und kein Superorganismus darstelle, der am Leben erhalten werden müsse, sei es schwierig, eindeutige Ziele für den Naturschutz abzuleiten. Daher sind anthropozentrische Werte notwendig, um eine Argumentationsgrundlage zu schaffen.
Der Historiker Niewöhner argumentiert ebenfalls gegen eine physiozentrische Perspektive, da er befürchtet, dass dadurch menschliches Leid relativiert werden könnte, z. B. in den Auswirkungen von Naturkatastrophen. Sowohl Kirchhoff als auch Niewöhner sind der Meinung, dass der Schutz der Biodiversität für den Menschen von großer Bedeutung ist und berücksichtigt werden muss, jedoch aus einer anthropozentrischen Perspektive, die sowohl instrumentelle als auch nicht-instrumentelle Werte der Natur einschließt. Es ist sogar möglich, dass bei der Verfolgung von Naturschutzzielen beide Sichtweisen berücksichtigt werden müssen. So behauptet Niewöhner: „Es ist legitim zu sagen: ‚Wir sind Menschen und interessieren uns für Menschen‘ – aber die Selbsterhaltung kann nur durch die Erhaltung der Ökosysteme gelingen.“. Daher ist es wichtig, die Verflechtung zwischen Menschen und Ökosystemen in der Gesellschaft stärker zu betonen und zu thematisieren.

Es müsste jedoch allgegenwärtig bekannt sein, dass die Natur nicht nur aufgrund ihrer Biodiversität schützenswert ist, sondern auch wegen ihres positiven Einflusses auf unser Gehirn und unsere Gesundheit. Dieses Ergebnis hat die Lise-Meitner-Gruppe für Umweltneurowissenschaften am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung bestätigt. Ein bereits 60-minütiger Aufenthalt in der Natur, wie etwa das Spazierengehen, hat die Aktivität in der Amygdala (der Gehirnregion, die an der Stressverarbeitung beteiligt ist) reduziert. Die Studie zeigt ebenfalls, dass die Stadt ein Risikofaktor für psychische Störungen ist und dass es demnach vorteilhaft wäre in der Natur zu leben. Somit hat sie die Bedeutung des Lebensumfelds für die Gesundheit unseres Gehirns nachgewiesen, dementsprechend wäre beispielsweise der Aufenthalt in einem Wald eine effektive Maßnahme gegen psychische Probleme. Die Ergebnisse der Studie sind konsistent mit einer weiteren Studie aus dem Jahr 2017, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde. Angesichts dieser Tatsachen sollten wir uns bewusst sein, dass die Natur schützenswert ist und dass wir unser Möglichstes tun müssen, um die Sicherheit der Erde und ihrer verschiedenen Lebensformen zu erhalten.
Während einige Menschen kaum oder gar nicht vom Klimawandel betroffen sind, leiden viele andere bereits unter den fatalen Folgen der Erderwärmung. Dazu gehören Verlust von Häusern, Land und Lebensgrundlagen sowie Hunger und Armut aufgrund von extremen Wetterbedingungen, Überschwemmungen und Dürren. Der Klimawandel stellt die Hauptursache für all diese Auswirkungen da und bedroht somit die Existenz zukünftiger Generationen.
Bereits seit der Industrialisierung kam es zu immer mehr Ausstoß der Treibhausgase, z. B. gelangt Kohlenstoffdioxid durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen in unsere Erdatmosphäre, was zu einem Anstieg der Temperatur führt. Diese vom Menschen verursachte globale Erwärmung wird als anthropogener Klimawandel bezeichnet und ist zu mehr als der Hälfte auf Kohlenstoffdioxidemissionen zurückzuführen. Die heutigen Kohlenstoffdioxidkonzentrationen sind bereits um etwa 40 % höher als zu Beginn des 19. Jahrhundert, doch leider scheinen sie nicht effektiv verhindert zu werden, sogar im Gegenteil, die Ressourcen, die normalerweise unser Klima regulieren, werden vernichtet. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der tropische Regenwald. 158.000 Quadratkilometer tropischer Regenwald werden jedes Jahr abgeholzt, wobei dieser bis zu 30 % der weltweiten Emission bindet. Doch desto mehr Bäume verschwinden, desto mehr Kohlenstoffdioxid gelangt in die Atmosphäre und desto wärmer wird die herrschende Temperatur auf der Erde. Es bedarf auch einer Unterstützung für Gemeinschaften, die besonders von den Auswirkungen der Klimakrise betroffen sind, um ihnen zu helfen, ihre Lebensgrundlagen und Gemeinden zu schützen, denn obwohl hauptsächlich die großen Industrienationen für den Klimawandel verantwortlich sind, tragen vor allem die ärmeren Länder die Folgen. Jeder neunte Mensch auf dieser Welt leidet an Hunger und rund 98% davon leben im geografischen Süden. Die Bedrohung der Ernährungssicherheit ist am größten, da vor allem die Landwirtschaft unter den langanhaltenden Dürren und Hitzewellen leidet, was zu Ernteausfällen führt. Gleichzeitig gibt es Wasserknappheit und Überflutungsgefahr, die Felder und Infrastruktur zerstören. Der Klimawandel verschärft auch den Unterschied zwischen Arm und Reich um 25%, verglichen mit einer Welt ohne Klimawandel. Trotzdem scheint nicht genug getan zu werden, um diesen Notstand zu überwinden.
In Anbetracht all dieser Faktoren ist es offensichtlich, dass die Klimakrise eine der größten Herausforderungen ist, denen die Menschheit heute gegenübersteht. Es bedarf einer starken Führung, einer engagierten Zusammenarbeit und eines ganzheitlichen Ansatzes, um sicherzustellen, dass wir die Klimakrise erfolgreich bekämpfen und eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen können. Die Auswirkungen der Klimakrise können bereits heute spürbar sein und werden in Zukunft noch schwerwiegender werden, wenn wir nicht schnell handeln. Es müssen interdisziplinären Herangehensweise konzipiert werden, die sowohl technische als auch politische und soziale Lösungen beinhaltet. Es bedarf einer Zusammenarbeit auf globaler Ebene, um sicherzustellen, dass alle Länder ihren Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Politische Maßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um den Übergang zu erneuerbaren Energien und einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Dies beinhaltet die Förderung erneuerbarer Energien, die Verringerung von Treibhausgasemissionen und den Ausbau von Energieeffizienzmaßnahmen. Es bedarf auch einer angemessenen Finanzierung für Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zur Bekämpfung der Klimakrise zu fördern. Zusätzlich haben wir als Menschen eine enge Beziehung zur Natur und sind von ihr abhängig. Wenn wir die Natur dementsprechend nicht schützen und respektieren, kann dies direkte Auswirkungen auf unsere eigene Gesundheit und Wohlbefinden haben. Die Klimakrise zeigt uns auch, dass unser Handeln Auswirkungen auf die gesamte Menschheit hat. Es geht nicht mehr nur darum, was wir als Individuen tun, sondern auch darum, wie wir als Gesellschaft und als globale Gemeinschaft handeln. Jeder von uns hat eine Verantwortung, zu handeln und zu agieren, um die Klimakrise zu bekämpfen, daher ist es unerlässlich, dass wir uns jetzt aktiv für eine nachhaltige Zukunft einsetzen und alles in unserer Macht Stehende tun, um die Klimakrise zu bekämpfen.
Quellenverzeichnis:
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/letzte-generation-was-die-klimaaktivisten-fordern-und-warum,TPQweZm
https://www.umweltethik-wiki.uni-kiel.de/doku.php/wiki:physiozentrismus
https://www.die-debatte.org/biodiversitaet-mensch/
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/radikale-klimaproteste-101.html
https://www.liberties.eu/de/stories/was-ist-ziviler-ungehorsam-definition-beispiele/44569
https://www.mpib-berlin.mpg.de/pressemeldungen/wie-beeinflusst-die-natur-das-gehirn
https://www.welthungerhilfe.de/informieren/themen/klimawandel
https://www.de-ipcc.de/media/content/IPCC-SynRepComplete_final.pdf
Wer regelt das mit dem Klimawandel? Unternehmen und ihre Pflichten
https://www.grin.com/document/97203
Die Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung zum
12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23
Die Klimakrise

Die Landschaft bei Bad Harzburg in der Klimakrise
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So werden bevorzugt Themen gestellt, die entweder sehr aktuell sind oder im Interessenhorizont vieler Schüler*innen liegt. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc. Das Thema wird jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.
Ausschreibungstermin ist jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtsferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturient*innen noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner*innen-Produkts erfolgt am 22. April, Kants Geburtstag. Urkunden und Preise werden dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer*innen.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23:
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Die Klimakrise“
Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion über die Klimakrise. Wenn das Wetter zunehmend verrückt spielt, Tornados und Überschwemmungen erzeugt, wenn die Gletscher schmelzen und Dürrekatastrophen zunehmen, dann stimmt etwas nicht mit dem Klima. Wir spüren wir die Folgen der selbstverschuldeten Klimaveränderung aufgrund des weltweit immer noch zunehmenden CO-2-Ausstoßes schon seit vielen Jahren. Dennoch fahren so viele Autos auf unseren Straßen wie noch nie. Was bedeutet Klima für unseren Begriff von Natur, was für die Evolution oder die Schöpfung? Inwiefern ist der Einzelne, der Staat, die Wirtschaft oder andere Organisationen für das Klima verantwortlich und was können wir für seine Rettung tun? Wir verhalten wir uns klimaethisch gut? Was macht der Mensch mit dem Klima und was macht das Klima mit uns? Welche Freiheiten sollen, wollen und dürfen wir zum Zweck des Klimaschutzes einschränken? Und wer kann darüber entscheiden?
Fragen über Fragen, ganz grundsätzlicher Art! Die eine oder andere davon könntest du in deinem Essay beantworten.
Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie du das Thema angehst: Ethisch, anthropologisch, naturphilosophisch, technikphilosophisch, wissenschaftsphilosophisch, gesellschaftskritisch, staats-, religions- oder sogar neurophilosophisch.
Wie beurteilst du die gegenwärtige Klimakrise? Du kannst „frei“ und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du das Thema in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, die zur Orientierung im Leben beitragen können. (Philosophieren heißt schließlich, sich in Grundfragen des Denkens, Lebens und Handelns zu orientieren.) Als philosophisch tiefsinnige Reflexion habe ich gerade Folgendes gelesen:
„Dass so viele Menschen die Klimakatastrophe nicht wahrhaben (wollen), ist natürlich ihren materiellen Interessen in einer Ökonomie geschuldet, die alles Lebendige in Geldbeträge verwandelt. Doch auch das komplexe Verhältnis von Teil und Ganzem wirkt sich hier aus. Die Klimakatastrophe ist ein begriffenes, weil in einen Begriff gefasstes Ganzes; sie ist als Begriff abstrakt, nichtsdestoweniger real als Zusammenhang ihrer Momente. Vom Vereinzelten aus ist das Ganze nicht erkennbar, nicht von dieser oder jener Überschwemmung, von diesem oder jenem Sturm oder Waldbrand aus; eine Bezeichnung wie Jahrhundertflut unterstreicht noch die Vereinzelung. Oder der gedankenlose Satz eines Wetteronkels im Fernsehen: ‚Der Sommer 2019 wird vielleicht als der heißeste Sommer in die Geschichte eingehen.‘ Erst der im Ganzen begriffene Zusammenhang der einzelnen Momente macht das Vereinzelte durchsichtig für die Wahrheit des Ganzen, das freilich ohne die einzelnen Momente nicht wäre.“ (Wolf Wucherpfennig: Kritische Ästhetik der Fremdheit. Abschließende Essays, Würzburg 2022, S. 88).
Dieser „Wahrheit des Ganzen“ solltest du in deinem Essay auf die Spur kommen. Dazu gibt es jetzt noch einen brandaktuellen und leicht lesbaren Einstiegs-Beitrag von Ulrike Hermann: Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden, Kiepenheuer und Witsch 2022.
Zur Ausformulierung eines ökologischen Imperativs im Anschluss an Kant vgl. Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt a.M. 1984.
Dein Text soll maximal 4 Computer geschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangs-Stufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisch-begriffliches (nicht nur fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität.
Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays oder anderen Beitrags über „Die Klimakrise“!
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
12. HCG-Philo-Wettbewerb 2022/23
Ausschreibung: Am 17.11.2022, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und 9. wie 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays oder anderen Beitrags zum Thema „Die Klimakrise“.
Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Einsendeschluss: Am 12.02.2023 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/innen: Am 22.04.2023 (Kants Geburtstag)
Preis: Ehrung, Bücher und Urkunden für die drei besten Texte
Der HCG-Philo-Preis 2021/22
Die Gewinnerinnen und ihre Essays
GELD GELD GELD
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema „Das Geld“,
so lautete die Aufgabenstellung für den 11. HCG-Philo-Wettbewerb (2021/22).
96 Schüler:innen haben sich mit dem Thema beschäftigt und einen Essay zum Thema eingereicht. Die Philosophie-Lehrer:innen des Hans-Carossa-Gymnasiums haben sie sich alle angesehen und drei Essays als besonders gelungen prämiert.
Die Gewinnerinnen und ihre Essays
1. Preis
Geld kann nicht ohne klare Regeln funktionieren
Charlotte Heidelbach (4. Semester)
2.Preis
Alles haben und noch mehr wollen : Betrug in großem Stil
Lisa Hahn (2. Semester)
3.Preis
Das Geld verbiegt den Verstand und untergräbt die Moral
Lisa Wilde (2. Semester)
1. Preis
Charlotte Heidelbach (4. Semester)
Geld kann nicht ohne klare Regeln funktionieren

Abstract: Ein Verzicht auf Geld stellt langfristig keine Lösung, sondern einen sozialen Rückschritt dar. Die Bedeutung dieses Zahlungs- und Tauschmittels darf aber auch nicht überschätzt werden. Desto wichtiger ist es, klare Regeln im Umgang mit Geld vorzugeben, damit keine größeren Ungerechtigkeiten und schwerwiegende Armut entstehen. Dafür sollte insbesondere Regelbrüchen wie Diebstahl, Korruption oder Steuerbetrug nachhaltig vorgebeugt werden.
Geld ist ein Konstrukt, welches jeden von uns seit dem ersten Tag seines Lebens, bis zum letzten, begleitet. Es wird täglich weltweit genutzt, und beeinflusst jeden Menschen in seinem Leben, seinen Emotionen, seinen Überlegungen und seinen Handlungen auf irgendeine Art und Weise. Für den einen bedeutet es mehr, für den anderen weniger, doch für alle von uns spielt es eine erhebliche Rolle, denn ein Leben ohne Geld wäre in unserer Gesellschaft wohl für niemanden ernsthaft vorstellbar.
Um das Geld soll es in diesem Text gehen. Genauer genommen um die Bedeutung des Geldes für das gesellschaftliche Zusammenleben und den Menschen als Individuum in einem Wirtschaftssystem. Als Fundament sollten ein paar Fragen geklärt werden, um diese später als Ausgangspunkt nutzen zu können. Die Antworten, welche im Zusammenhang mit meinen Überlegungen stehen, sind häufig subjektiven Ursprungs, haben oftmals einen weiten Interpretationsspielraum und somit zahlreiche Alternativen.
Die Frage „Was ist Geld?“ sollte als Grundlage vorerst geklärt werden. „Durch das Geld werden die verschiedensten Güter kommensurabel, womit es Gleichheit zwischen ihnen herstellt“ schrieb Aristoteles vor etlichen Jahrhunderten und behielt damit wohl bis heute Recht, denn beim Geld handelt es sich immer noch um ein anerkanntes Tausch- und Zahlungsmittel. So entspricht ein bestimmtes Gut einem eindeutigen Geldwert und ein Handel entsteht, der durch das Geld vereinfacht und einheitlich durchgeführt werden kann. Ein weiterer wichtiger Terminus ist wohl der Begriff der Gerechtigkeit, welche nach Jean-Jaques Rousseau darin besteht, einer fremden Person als solcher gerecht zu werden, ihr gegenüber Toleranz und Aufrichtigkeit zu erweisen, sie nicht in ihrem Freiheitsraum einzuschränken und ihre Handlungsfreiheit nicht zu beeinträchtigen. So ist für jede Person die Voraussetzung zur Verwirklichung ihrer Werte und Vorstellungen geschaffen, weshalb ich diese Definition bezüglich des Geldes im gesellschaftlichen Miteinander als sehr bedeutungsvoll ansehe.
Trotzdem scheint Geld im Zusammenleben so bestimmend und wichtig zu sein, dass es immer wieder Streitigkeiten, Beschwerden und Ungerechtigkeit bei der Verteilung gibt. Wir brauchen das Geld. Zum Wohnen, Essen, Lernen, Arbeiten, Fortbewegen und vielem mehr. Geld wandert täglich von der einen Hand in die andere und grundsätzlich birgt dieser Kreislauf kein Konfliktpotenzial. Doch schon seit den ersten Anfängen von Sozialisation, in der Antike, im Mittelalter und der Neuzeit war Geld zwar einerseits ein sehr hilfreiches Mittel der Wirtschaft, auf sozialer Ebene allerdings auch oft ein großes Hindernis. Immer wieder ist die Rede von einem endlosen Verlangen immer mehr haben zu wollen, Gier und Konsumsucht, die nicht selten im menschlichen Zusammenleben auftreten. Aristoteles als Realist kritisiert die Lebensweise, kontinuierlich nach Geld zu streben und nie genug haben zu können, denn diese verkenne das Wesen des Geldes und nutze es zum Selbstzweck. Somit wird Gier zum zentralen Begriff einer gewissen Ungerechtigkeit, welche die Quelle der Konflikte bildet.
Ein weiterer Philosoph und Soziologie, welcher wohl oft mit dem Geld der heutigen Zeit in Verbindung gebracht wird ist Georg Simmel, welcher die Grundlagen der Auffassung des Aristoteles weiterführt und die Entwicklung des Geldes vom Tauschmittel zum Selbstzweck und sogar zum Religionsersatz betrachtet. „Das Geld hat jene positive Eigenschaft, die man mit dem negativen Begriff der Charakterlosigkeit beeinflusst“, schrieb er und zielte dabei wohl auf die heutzutage sehr aktuelle Geldherrschaft, das System des Kapitalismus (Angebot und Nachfrage bestimmen Markt und Produktion und das Kapital befindet sich im Besitz von Unternehmern) und die seiner Meinung nach negative Entwicklung des Konstrukts Geld ab.
Wird nun das Geld ungleichmäßig verteilt, sodass einer weniger hat als der andere, obwohl die beiden vielleicht sogar die gleiche Arbeit verrichtet haben, entsteht Ungerechtigkeit. Wer sich ungerecht behandelt fühlt wird unzufrieden und beschwert sich früher oder später, wodurch Konflikte entstehen. Aber wer bestimmt in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, in das jeder von uns hineingeboren wurde, was eine gerechte Verteilung ist? An welchen Maßstäben wird gemessen? Ist es die Zeit, in der wir arbeiten, die Ausbildung und das Studium, welche wir absolviert haben, die Leistung, die wir bringen, das Land, in welches wir geboren wurden, die Wertschöpfung, das Geschlecht oder vielleicht die Exklusivität unserer Arbeit, die unsere Bezahlung und Anerkennung innerhalb der Gesellschaft bestimmt? Vielleicht ist es einfach, zu behaupten, es seien alle Aspekte, die in die Bezahlungsregelung unseres Systems einfließen, jedoch teile ich diese Überzeugung grundlegend. Geld kann nicht ohne bestimmte Regeln funktionieren. Diese sollten klar und deutlich formuliert sein, damit jedes Mitglied der Gesellschaft und des Wirtschaftswesens sie versteht und einhalten kann. Jedoch kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die festgelegten Regeln, die es schon seit Jahrhunderten gibt (auch wenn sie sich immer wieder leicht verändern). Korruption, Steuerhinterziehungen, Diebstahl und viele weitere Regelbrüche kommen nicht selten vor, und obwohl man eher eine erzürnte, aufgebrachte oder bestürzte Reaktion der Menschen vermuten würde, kommt aus dem Volksmund eher ein „Ach, schon wieder?“, solange diese Regelbrüche einen nicht selbst betreffen. Die Reaktionen passen sich den Aktionen an und gewinnen an Normalität.

Geschredderte Geldscheine
Unser Wirtschaftssystem basiert zudem auf Vertrauen. Wenn wir in die Bank gehen und 300 Euro abheben, bekommen wir vielleicht drei Hunderteuroscheine. Wir bekommen Papier, welches in der Herstellung einen reinen Wert von wahrscheinlich unter einem Euro hat. Aber wir vertrauen auf unser System, welches uns vorgibt, das Papier sei 300 Euro wert. So gehen wir in den Supermarkt, nehmen uns Nahrungsmittel und geben dafür unser abgehobenes Geld. Auch hier besteht ein grundlegendes Vertrauen, denn wir gehen optimistisch erst einmal davon aus, dass unser Gegenüber uns die passende Summe an Restgeld erstattet. Genauso geht unser Gegenüber davon aus, dass wir nicht heimlich mit einem Komplizen seine Kasse ausräumen. Auch wenn wir vermutlich still unser Restgeld zählen und unser Gegenüber die Möglichkeit einer Straftat im Hinterkopf behält, herrscht ein grundlegendes Vertrauen, auf das unsere Interaktion gestützt ist. Theoretisch kann so ein funktionierender Handel stattfinden, würde es nicht immer wieder zu Regelverstößen kommen.
Dabei kommt es im Alltag womöglich oft zu „kleinen“ Regelverstößen wie Diebstahl, kann aber auch zu „großen“ Verbrechen wie Korruption kommen. In beiden Fällen wird eine bestimmte Vertrauensstellung missbraucht, wobei sich die Art des Vertrauens in beiden Fällen unterscheidet. Betroffen sind wir jedoch alle, da der Kreislauf der problemlosen Nutzung von Geld gebrochen wird. Doch wie kommt es eigentlich zu diesen Regelbrüchen? Ist es die maßlose Gier, immer mehr haben zu wollen, gibt es Fehler im System, oder ist es der Drang etwas Verbotenes zu tun? Meiner Meinung nach kann man dies oberflächlich in zwei verschiedene Gruppen einteilen, ohne die Intentionen der Menschen, welche Regelverstöße begehen, zu kennen.
Die erste Gruppe schließt Menschen ein, welche das System des problemlosen Geldkreislaufes brechen ohne dies wirklich „nötig“ zu haben. Das könnten zum Beispiel Unternehmer sein, welche Millionen auf dem Konto haben und durch Lobbyismus und Korruption versuchen noch reicher zu werden. Bei dieser Gruppe spielt sicherlich Gier, Unersättlichkeit und Habsucht oftmals eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für ein solches Vergehen. Die zweite Gruppe ist jedoch betroffen von dem entscheidenden Fehler des Systems (welche diese sind erläutere ich später) und verstößt aus Notwendigkeit gegen die bestehenden Regeln. Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise Menschen, die stehlen müssen um ihre Familie und sich selbst zu ernähren oder sich bilden zu können.
Bei der ersten Gruppe sehe ich ein grundlegendes Problem, bei der zweiten jedoch einen Fehler im System. Ist es gerecht, dass Menschen in Deutschland oder anderen Ländern der EU, wo es meist eine soziale Marktwirtschaft gibt, wodurch die Länder teilweise zu den reichsten der Welt gehören, in Armut leben müssen, obdachlos sind, oder sich nicht bilden können, weil sie nicht das Geld dazu haben? Ist es gerecht, dass viele Menschen aus meiner Generation nicht die Chance dazu haben, das zu studieren, was sie wollen, weil ihre Eltern dies nicht bezahlen können?
Oftmals wird auf Chancengleichheit verwiesen, wobei allerdings nicht bedacht wird, dass nicht alle Menschen den gleichen Startpunkt haben. Fuchs und Schnecke müssen beide gleichzeitig 50 Meter unter den gleichen Bedingungen laufen. Klingt doch gerecht, oder? Bei diesem wohl sehr offensichtlichem Beispiel ist uns die Antwort wohl allen klar. „Nein, das ist nicht gerecht, da die Schnecke aufgrund ihrer physiologischen Bedingungen nicht so schnell laufen kann wie der Fuchs.“ Wird dies jedoch auf die Realität bezogen, scheint die Klarheit zu schwinden. Chancengleichheit mag in einigen Fällen als Idee wirklich zu funktionieren, ist aber keine keinesfalls auf jede Situation und Beurteilung anwendbar, sodass meiner Meinung nach eine individuelle Betrachtung jedes Einzelnen nötig ist, um Chancengleichheit herzustellen zu können. Denn diese ist meines Erachtens nach nicht gegeben, sondern muss durch unsere Initiative so ausgerichtet werden, dass Gerechtigkeit in der Gesellschaft entsteht und alle Mitglieder der Gemeinschaft die gleichen Möglichkeiten haben.
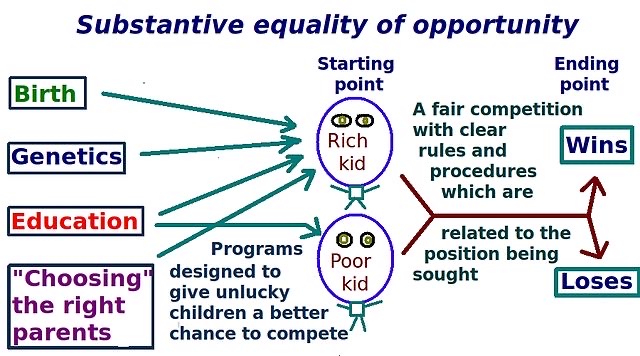
Ein Modell der Chancen(un)gleichheit
„Beim Geld endet die Freundschaft“ heißt es, womit Geld in unserer Gesellschaft offensichtlich eine extrem bedeutende Rolle einnimmt. Geben wir dem Geld vielleicht mehr Bedeutung als es eigentlich besitzt? Dinge sind das, was wir daraus machen, ist wohl etwas leicht gesagt. Denn eine gewisse Bedeutung müssen wir dem Geld zwangsläufig zuschreiben um ein vernünftiges Leben führen zu können. Jedoch sollte womöglich oftmals die wirkliche Bedeutung des Geldes überdacht werden. Wirtschaft, Systeme und andere Menschen geben uns die Bedeutung des Geldes vor, jedoch schon in einer bewerteten Variante. Dabei scheint das Geld nicht nur bloß ein Zahlungsmittel zu sein, sondern eine elementare Bedeutung für uns zu haben. „Mehr Geld desto besser“ oder „Sichere deinen Besitz ab, indem du sparst“ schwingen dabei oftmals als Botschaften mit. Vielleicht brauchen wir auch eine andere Perspektive, um dem Geld in der Gesellschaft wieder die Bedeutung zu nehmen, und es vorerst als Zahlungsmittel zu sehen, was wir alle brauchen. Dabei können wir genauso zusammenwirken und müssen uns nicht gegeneinanderstellen, um das zu erreichen, was wir wollen. Stellen Sie sich vor, Sie leben nächstes Jahr auf einem anderen Planeten mit einer ganz anderen Finanzregelung. Ist es dann wichtig, hier auf der Erde Millionen zu besitzen?
Ich möchte die Bedeutung des Geldes nicht komplett in Frage stellen. Sicherlich ist es richtig, sich vorsorglich einen finanziellen Plan zu machen oder überschaubare Rücklagen für eine finanzielle Notlage zu haben. Vielmehr sollte überdacht werden, was wir wirklich brauchen und was wir nur besitzen oder kaufen, um es zu haben und unsere Habgier und Konsumsucht zu befriedigen.
Es gab schon etliche Modelle finanzieller Regelung, die zum Scheitern verurteilt waren. Steht die Gesellschaft nicht vielzählig hinter einer Idee, kann sie langfristig auch nicht umgesetzt werden. Ein Wirtschaftsmodell, welches nur von einem kleinen Teil der Gesellschaft befürwortet wird, wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Es gibt viele theoretische Ideen wie „Jeder nimmt, was er braucht und gibt, was er kann“, die sich praktisch jedoch nicht durchgesetzt haben. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Geld, Besitz und Vermögen in unserem aktuellen System eine viel zu große Bedeutung besitzen und somit an vielen Stellen für Unfrieden sorgen. Die Gesellschaft ist geprägt vom Geld und seinem Gewicht und dies färbt natürlich auch auf uns Menschen als Individuen ab. Schon von klein auf lernen wir die grundlegende Wertschätzung des Geldes innerhalb des Gesellschaftssystems kennen und uns wird der Drang nach Besitz schon früh übermittelt. Oftmals nimmt diese Idee jedoch Überhand und haben wir das Gefühl, Geld schränke unsere Freiheit in jeglichen Lebensbereichen ein und je älter wir werden, desto wichtiger ist es uns, eine sogenannte „Lebensgrundlage“ (Alterssicherung) zu haben. Hier müssen wir auch zwischen Geld und Vermögen unterscheiden. Geld dient als Zahlungsmittel, Vermögen bedeutet eine gewisse finanzielle Sicherheit.
Zusammenfassend kann nun gesagt werden, dass Geld wohl das Leben der meisten zumindest teilweise bestimmt. Meiner Meinung nach ist genau dies der Punkt, an dem wir aus dem Finanzzirkel ausbrechen müssen und uns eine individuelle Bedeutung des Geldes klar machen sollten. Leitbegriffe wie Glück, Zufriedenheit oder Gesundheit, welche sich wohl viele Menschen in ihrem Leben wünschen, haben ihren Ursprung nicht beim Geld. Eine Regelung ohne Geld ist für uns nicht vorstellbar und dies sollte auch gar kein Ziel sein. Vielmehr bin ich der Meinung, dass das Geld seine Stellung als reines Zahlungsmittel zumindest grundlegend zurückerlangen sollte und keineswegs einen so großen Einfluss auf das gesellschaftliche Zusammenleben und damit auf das Individuum haben dürfte, sodass es erst gar nicht zu so vielen Regelverstößen innerhalb unseres Geldsystems kommt. Welche Bedeutung das Geld hat und wie es den Menschen als Individuum beeinflusst, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden, jedoch sollten Habgier und Verlangen keine Leitmotive für ein gesellschaftliches Zusammenleben sein.
Quellen:
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/immanuel-kants-erkenntnisse-ueber-geld-sind-aktueller-denn-je-15767076.html (08.01.2022, 13:58)
https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/philosophie-des-geldes/3412 (08.01.2022, 13:59)
https://www.springer.com/de/ueber-springer/medien/pressemitteilungen/psychologie/wie-geld-unser-leben-beeinflusst/13313566 (08.01.2022, 15:58)
https://www.juraforum.de/lexikon/gerechtigkeit
Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
2.Preis
Lisa Hahn (2. Semester)
Alles haben und noch mehr wollen : Betrug in großem Stil
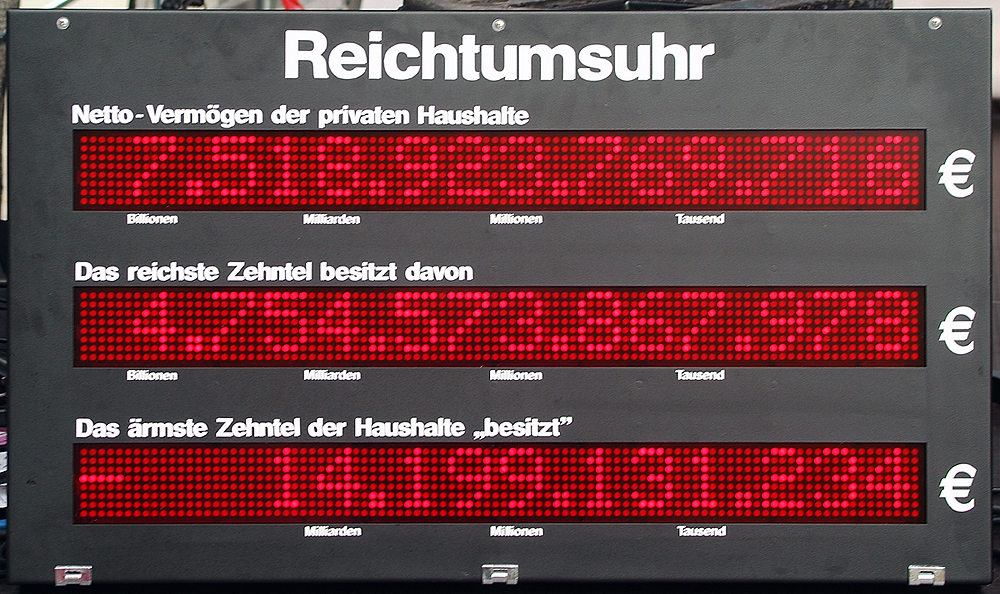
Abstract: In ihrem „Brief über das Geld und die Welt“ erinnert Lisa ihren Freund Will daran, dass Geld keine Garantie für Glück darstellt. Es eröffne zwar Möglichkeiten und schaffe Sicherheiten. Doch wenn es zum Selbstzweck werde und noch über der Moral stehe, versperre es auf betrügerische Weise den Blick für alles das, was keinen Preis, sondern eine Würde hat (Kant).
Lieber Will,
der erstaunlich ernste Ton in Deinem letzten Brief hat mich zugegebenermaßen dezent überrascht. Dabei sollte es mich wahrscheinlich nicht wundern – wie ich hörte, regiert Geld die Welt, Dich eingeschlossen. Deine Sorge bezüglich der Inflation ist berechtigt, keine Frage, dennoch hat mich der letzte Teil deines Briefs mehr interessiert: „Zeit ist Geld – Geld ist Zeit und ich habe keine Zeit mehr zum Glücklichsein – hätte ich doch zusätzliche ein, zwei Tausend Euro.“
Obwohl ich den Zusammenhang nachvollziehe, gefällt mir diese feste Vernetzung von Geld, Zeit und Glück in Deinen Gedanken nicht. Deswegen fällt es mir umso leichter, Deiner Bitte nachzukommen, dir meine Gedanken über Geld vorzustellen. Du wirst wohl verstehen, wenn ich Überlegungen über Glückseligkeit auch mit hereinfließen lasse.
Deine letzten Sätze lassen darauf schließen, dass du Geld sowohl mit Zeit als auch mit Glück verbindest. Viele werden dir da zustimmen, ich tu das auch. In unserer Welt sind Geld und Glück miteinander verbunden und ich persönlich finde dies mehr als beunruhigend, aber dazu später mehr.
Zuerst möchte ich über die offensichtlichste Frage sprechen, die sich nun stellt: macht Geld glücklich? Ja und nein: Geld ist definitiv keine Garantie für ein glückliches Leben, jedoch stehen die Chancen glücklich zu werden mit Geld allgemein besser als ohne. Dies denke ich, da die meisten Menschen in unserer heutigen Zeit nicht genügsam sind, ein Handy, ein Haustier, Bücher oder einen Streaming-Service haben wollen und dementsprechend ohne diese Dinge eher unglücklich sind. Diese bekommt man jedoch nur mithilfe von Geld, weshalb es offensichtlich ist, dass Geld für viele das Erreichen von Glück bedeutet oder es zumindest erleichtert. Zudem eröffnet einem ein erhöhter Geldbetrag mehr Möglichkeiten, in der Welt rumzukommen oder seine Wünsche zu verwirklichen, da es unser Tauschmittel, unser Zahlungsmittel, ist. Ich möchte jedoch klarstellen, dass es immer noch gewisse Dinge gibt, die man nicht für Geld kaufen kann. Zur Verdeutlichung ein prominentes Beispiel: „Alles in dieser Welt hat entweder einen Preis oder eine Würde“ sagte Kant. Also gibt es einen bestimmten Teil, den man kaufen kann und einen, den man nicht kaufen kann- einen wahren Freund beispielsweise. Glaub mir, mit Geld hättest du mich nicht kaufen können – das schafft nur dein ehrlicher, gutmütiger Charakter sowie deine aufrichtigen Bemühungen. Um wirklich klarzumachen, was ich meine, will ich noch ein weiteres Beispiel nennen: Ich persönlich verspüre Glück, wenn es stürmt, gewittert, meine Großmutter mich umarmt, oder wenn ich ein bisschen Ruhe habe. Das Aufgezählte kann man nur bedingt mit Zeit kaufen (wenn man viel Geld hat, muss man nicht arbeiten und bekommt somit mehr Ruhe).
Jedoch nun das Entscheidende: die Dinge sähen ganz anders aus, wenn ich kein sicheres Dach überm Kopf, kein Essen auf dem Teller oder kein trinkbares Wasser hätte. Ohne diese Sachen – welche ich bei der vorigen Aufzählung vorausgesetzt hatte – könnte mich ein Gewitter oder ein bisschen Ruhe nicht halb so glücklich machen. Also hat Geld zwar Einfluss auf das Glück, jedoch nicht totalen, da es nicht allmächtig ist, man für Geld nicht alles bekommen kann.
Somit ist sehr deutlich geworden, weshalb man Geld nicht mit Glück gleichsetzten kann, obwohl es einem in unserer Welt selbstredend mehr Chancen und Freiheit ermöglicht.
Doch hat Geld noch andere Funktionen als den Bezug zum Glück? Steigt zu viel Geld möglicherweise zu Kopf? Eine andere Andeutung, die ich oft höre. Aus eigener Erfahrung kann ich nicht sprechen, weshalb ich hier nicht zu generell herangehen möchte.
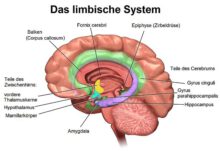
Ist das zerebrale Gefühlszentrum für unsere Geldgier verantwortlich?
Ich bin mir sicher, dass Geld nicht gleich viel Macht auf jeden Menschen ausübt, es jeder individuell aufnimmt, da ich schon unterschiedliche Reaktionen zu Geld als Geschenk gesehen habe und daraus schlussfolgere, dass die Reaktion auf den Besitz von viel Geld zumindest teilweise vom Charakter abhängt. Deshalb nehme ich an, dass manche Personen durch den Besitz von viel Geld arrogant und abgehoben werden, während andere bestimmt realitätsbewusst und bescheiden bleiben. Hier kommt es jedoch höchstwahrscheinlich auch zu Teilen auf die Erziehung und das Umfeld in der Kindheit an. Wenn man beispielsweise früher ohne viel Geld aufgewachsen ist und vorgelebt bekommen hat, dass man auch so gut und glücklich leben kann, halten diese Erinnerungen einen auf dem Boden der Tatsachen. Andererseits kann Geld bezogen auf die ärmere Kindheit auch schnell zu Kopf steigen, da man von den neuen Möglichkeiten und Dimensionen überwältigt ist – möglicherweise auch ohne genügend Geld keine gute, angenehme und zufriedenstellende Kindheit hatte. Jedoch kann einem Geld auch zu Kopf steigen, wenn man reich aufgewachsen ist, da man es gar nicht anders kennt, somit nicht wertschätzt und die Realität ganz anders wahrnimmt als die anderen gesellschaftlichen „Schichten“. Dies ist meiner Meinung nach auch der Grund, weshalb ebendiese Schichten solche Leute als abgehoben betiteln oder eben meinen, ihnen sei das Geld zu Kopf gestiegen. Sie haben einfach andere Auffassungen von viel und wenig, von selbstverständlich und von besonders.
Doch das ist nicht das Interessante, mich interessiert viel mehr, weshalb es dazu gekommen ist, dass man sagen kann „Geld steigt zu Kopf“. Geld muss einen enormen Wert haben, damit so etwas gesagt wird. Somit drängen sich mir zwei Fragen auf: was ist Geld überhaupt und welchen Wert hat es?
Geld ist ein einheitliches Tauschmittel, was es zu unserem Zahlungsmittel macht. Es wurde in der Antike eingeführt, als noch Tauschhandel betrieben wurde. Nach der Einführung der Münze gab es einen Aufschwung in der Wirtschaft: das Zahlmittel Geld ist also effizient und deshalb wird es auch heute noch benutzt. Ohne Fragen ist Geld aber für manche noch viel mehr als das. Doch wie und weshalb? Nun, die Herstellung von 500 Euro kostet 16 Cent. Der materielle Wert von 500 Euro liegt also nur bei 16 Cent. Daraus wird deutlich, dass unsere Gesellschafft dem Geld so einen großen Wert gegeben haben muss. Man könnte zwar sagen, objektiv gesehen ist ein Euro ein Euro oder sind 500 Euro 500 Euro. Subjektiv gesehen sind ebendiese 500 Euro jedoch auch gleichzeitig eine halbe Monatsmiete – für Menschen ist Geld also viel mehr als sein materieller Wert oder auch nur der ihm gegebene Wert. Geld steht für Möglichkeiten, Sicherheit, Stabilität und Freiheit – alles Dinge, die sehr wichtig im menschlichen Leben sind: wenn ich mich jeden Tag sorgen müsste, wo ich die Nacht verbringe, könnte ich kaum ein erfülltes, zufriedenes Leben führen. Und all diese Dinge hängen nun mal vom Geld ab. Deshalb hat Geld eine so unglaublich große Bedeutung in unserer Gesellschaft, der Welt und im Leben. Wie Du in deinem Brief erwähntest, gibt es außerdem den Spruch „Zeit ist Geld“. Selbst die Zeit, unsere Existenz wird in Geld gemessen. Ich finde es faszinierend, wie du ihn zu „Geld ist Zeit“ umgewandelt hast, wodurch der Bezug von Geld zu Glück und somit seine starke Bedeutung in unserem Leben noch deutlicher dargestellt wurde. Denn ja, ich stimme Dir zu, auch ich brauche Zeit, um meine Gedanken zu sortieren, Energie zu tanken und zu tun, was mir guttut, um glücklich(er) zu sein. Demnach brauche ich dafür Zeit und Zeit ist Geld, weshalb Geld Zeit ist: wenn ich genügend Geld hätte, um nicht (oder nur so viel ich wollte) arbeiten gehen zu müssen, hätte ich mehr Zeit, was wie gesagt zu mehr Glück führen würde. Somit beeinflusst Geld unser Leben, unser Denken und unser Handeln.
Jetzt wurde mehr als deutlich gemacht, wieviel Geld in unserer Welt bedeutet und dies führt mich unweigerlich zu der Frage: was machen Menschen alles, um an Geld zu gelangen? Da Geld bei uns für ein Mittel zum Glück steht, gehen viele Menschen sehr weit dafür. Viele betrügen für Geld und handeln gegen jegliche Moral, führen beispielsweise Raubüberfälle durch, um mehr Geld zu bekommen. Manche Menschen töten sogar für Geld. So eine Tat kann aus verschiedenen Gründen vollzogen werden: manche töten aus schierer Verzweiflung, da sie kein Geld haben und es dringend bräuchten, um beispielsweise Schulden zu bezahlen. Andere tun es aus primitiver Gier.
Geld, diese kleinen Metallstücken und das farbige Papier, macht Menschen (unter anderem) zum Mörder. Da drängt sich mir die Frage auf, inwiefern man die jetzigen Geldverhältnisse als moralisch bezeichnen kann, wenn sie manche Menschen so zum Verzweifeln bringen. Wenn die Verteilung streng doch fair erscheint, jedoch den Absturz der Ärmeren in Kauf nimmt, kann sie keinen hohen moralischen Wert besitzen. Der Staat muss also darauf achten, dass die Armen genug haben, den Reichen jedoch nichts grundlos weggenommen wird. Doch obwohl der Staat den Armen hilft, läuft irgendetwas falsch. Wie also sollte das Geld verteilt werden?
Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben und deshalb verdient jeder eine gewisse Grundsicherung, welche das Überleben sowie Aufstiegschancen sichert. Zu beachten ist jedoch, dass nicht jeder Mensch gleich viel Geld braucht: Menschen mit körperlichen oder mentalen Einschränkungen haben offensichtlich andere Bedürfnisse als Uneingeschränkte, brauchen beispielsweise einen Rollstuhl oder zusätzliche Betreuung. Doch letztendlich ändert das nichts an der Tatsache, dass jeder eine Grundsicherung haben sollte, da Menschen eine Würde besitzen, welche verletzt wird, wenn sie keine Chancen in dieser Welt bekommen, betteln und sich verkaufen oder verraten müssen. Trotzdem muss man auch etwas für sein Geld und diese Gesellschaft tun, da unser System aus Märkten und Firmen sonst gar nicht funktionieren würde. Weiterführend sollte es also der Fairness wegen verschieden hohe Gehälter geben, abgestimmt auf die Härte sowie den Aufwand der Arbeit, die man leistet. Milliardäre sind deshalb eher ein Extrem, welches ich als nicht richtig empfinde: wenn ich so viel Geld hätte, könnte ich dies nicht mit mir vereinbaren, wenn ich gleichzeitig Menschen verhungern sehe. Moralisch wertvoll ist das Horten von Geld jedenfalls nicht.
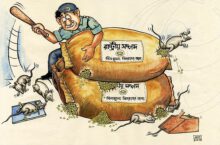
Jedoch war dies nur eine Weiterführung des Gedankenganges bezüglich der Verzweiflung. Was ist mit Diebstahl, Raub oder Mord aus Habsucht und Gier? Nicht, weil man es unbedingt bräuchte, sondern weil man es unbedingt haben will. Hier wird nochmals deutlich, wie Geld die Welt und uns Menschen im Griff hat. Ich bezweifle, dass man hier etwas tun kann, wenn die Moral komplett vergessen und Geld über sie gestellt wurde. Jetzt noch etwas Seltenes, noch Extremeres: wenn man eigentlich schon einen ordentlichen Geldbetrag besitzt, jedoch mehr und mehr will- nicht um des Glückes, der Sicherheit oder der Freiheit willen, sondern nur um es zu besitzen. Nicht weil man noch etwas damit kaufen möchte – nein, wenn man schon alles Erdenkliche hat und dennoch mehr Geld will – hier rede ich von Betrug im großen Stil. Diese Situation würde eintreten, selbst wenn wir die Fälle von Verzweiflung oder Traumerfüllung abziehen, doch wieso? Wie kommt es dazu, wenn es doch nicht mehr Luxus verschafft?
Weil Geld in unserer heutigen Welt nicht nur Glück, Macht, Möglichkeiten und Freiheit bedeutet, sondern auch zu einer Art Statussymbol wurde und manchen zu Kopf steigt, alles andere vergessen lässt. Ich kenne solche Leute nicht, kann Dir also nicht sagen, ob beispielsweise gutes Zureden oder starke Argumente helfen, um sie zu überzeugen, dass Tugenden wie Freundlichkeit und Güte mehr wert sind (oder sein sollten) als Unmengen an Geld, ich bezweifle die Wirksamkeit dieser Methoden jedoch. Vor allem, da in unserer Welt viele Menschen Freundlichkeit oder Güte nicht als wichtiger oder wertvoller denn Geld ansehen. Dass Geld einen hohen Wert für uns Menschen hat, ist nichts Schlechtes – nur ein Fakt, jedoch wird es durch den Egoismus der Menschen zu etwas Gefährlichem, etwas Negativem. Unsere Gesellschaft hat sich langsam so entwickelt, dass Geld beginnt, über allem zu stehen, auch über der Moral. Viele fragen sich nicht mehr, ob etwas gut oder böse, richtig oder falsch ist, heutzutage geht es vermehrt nur noch um die Frage der Bereicherung, um Geld und um Macht. Deswegen ist es so wichtig, sich darauf zu fokussieren, dass Geld niemals komplett ein Synonym für Freude und Glück sein kann: dass es Sachen gibt, die man nicht nur durch Geld erlangen kann und dass das Fokussieren auf diese Dinge auch zu Glück führen kann. Ja, Geld erleichtert vieles in einer Welt wie der unseren, aber dennoch hat es nicht Macht über alles und da kann man ansetzen. Beispielsweise hilft es, auf die Dinge, die man hat, zu achten und nicht die, die unerreichbar sind. Oder auf die Dinge, die man hat, welche einem Geld nie geben könnte: beispielsweise einen wahren Freund, liebevolle Eltern oder einen ehrlichen Partner. All diese nicht materiellen Dinge, sind ebenfalls so wertvoll und darauf sollte das Augenmerk gerichtet werden.
Während ich Dir diesen Brief schreibe, höre ich das Album „ULTRAVIOLENCE“ von Lana Del Rey. Gerade begann „MONEY POWER GLORY“ zu spielen. Ein unglaublich passendes Lied zu diesem Thema: denn lautstark singt sie im Refrain, dass sie Geld, Macht und Ruhm besitzen will. Dieser Refrain übertönt beinahe den anderen Text in den ruhigeren Strophen des Liedes. Jedoch kommt es auf genau diese an: denn während der Refrain genau den gleichen Eindruck wie unsere laute Welt erweckt, dass Geld und Macht und materielle Dinge am wichtigsten sind, wird in den Strophen klar, dass dieser Text vom Refrain absolut nicht ihrer ehrlichen Meinung entspricht. Denn eigentlich ist genau dieser Refrain sarkastisch gemeint, erklärte sie auch noch mal ausdrücklich in einem Interview. Das ganze Geld und die vielen Schlagzeilen wollte sie gar nicht: eigentlich wollte sie nur Gemeinschaft und Respekt. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich bezüglich der Position des Geldes in unserer Welt: viele schreien zu laut danach, als dass man die ruhigen Stimmen hören könnte, welche andere Dinge mehr wertschätzen; Dinge wie Familie, Freunde, Gutes und Tugenden. Dennoch gibt es somit auch Hoffnung, dass sich diese Welt und die Menschen ändern können und ich kann nur hoffen, dass dies eintritt und Tugenden bald für mehr Menschen über dem Geld stehen. Sodass Geld zwar immer noch bedeutend aber nicht mehr alles ist. Sodass Geld nicht mehr die Welt regiert.
Letztendlich möchte ich auch Dir nahelegen, Dich mehr auf die nicht materiellen Dinge und das, was du hast, zu konzentrieren. Somit fällt Dankbarkeit und Genügsamkeit leichter, was ebenfalls zu einer gewissen Glückseligkeit führt. Dadurch wird Geld auch nicht mehr so stark mit Deinem Glück verbunden sein, was definitiv die gesündere Einstellung ist. Denn wir wissen beide, dass der Trubel um das Erlangen von Geld definitiv nicht zum Glück führt. Also: ja, Geld führt häufig zu Glück, aber die richtige Einstellung tut das auch, auf einer gesünderen und mitfühlenderen Art und Weise.

Familie und trautes Heim – Glück allein?
Hiermit kann ich nur hoffen, dass mein Brief dich wohlauf findet und du auch ohne tausend zusätzliche Euros genügend Zeit hast, ihn in Ruhe und mit entspanntem Geist zu lesen. Vielleicht helfen Dir ein paar meiner Gedankengänge ja oder regen zumindest neue an.
Alles Gute und ganz liebe Grüße, Lisa
P.S.: Bitte vergiss nicht, dass der Besitz von Geld Glück erleichtert, der Weg zum Besitz von Geld einen jedoch ins Unglück stürzen kann.
QUELLEN:
https://hcg-berlin.de/faecher/philosophie/
Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
3.Preis
Lisa Wilde (2. Semester)
Das Geld verbiegt den Verstand und untergräbt die Moral

Abstract: Unser Wunsch nach Selbstbereicherung führt zu zahlreichen moralischen und gesetzlichen Verstößen bis hin zu schweren Verbrechen. Diese unrechtmäßige Aneignung von Geld ist nicht nur lust- und triebgesteuert (Freud). Arme reden sie sich als vermeintlich gerecht ein, Reiche wiederum folgen egoistisch dem kapitalistischen Prinzip der Geldvermehrung. Vernünftig wäre ein reflektierter, moralisch überprüfter Umgang mit dem Geld.
Das Geld ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Wir Menschen brauchen Geld, da unsere Gesellschaft darauf ausgelegt ist – und sich durch Jahrhunderte zu unserem heutigen Bild entwickelt hat -, um uns Güter kaufen zu können, die Produktion selbst kostet Geld und allein die Arbeit einer jeden Person resultiert in dem Erhalt des Gehalts. Selbst in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen ist die Rede von „der schwarzen Null“ und einer Spaltung von Arm und Reich. Kurzum, viele Aktionen in Gesellschaft und Politik, jedoch auch im eigenen Leben haben direkt oder indirekt mit dem Geld in verschiedenster Weise zu tun. Da das Geld eine dominierende Komponente in unserem Leben spielt, stellt sich die Frage, ob und wie das Geld oder genauer gesagt der Wunsch nach Selbstbereicherung unser Verhalten und Denken in der westlichen Welt bestimmt und ob dasselbe Verhalten vernünftig begründbar ist.
Korruption, (Erb-)Mord, Diebstahl, Bestechung, Ausbeutung, Schwarzarbeit – es gibt viele Straftaten, die nicht nur illegal, sondern auch ethisch gesehen illegitim sind und mit dem Geld und der Selbstbereicherung eng in Verbindung stehen. Korruption verstößt gegen die Gerechtigkeit in dem Aspekt, dass es keine Chancengleichheit zwischen den Bewerbern gibt. (Erb-)Mord verletzt die Würde des Menschen, da ein Leben beendet wird. Diebstahl verletzt das moralische Empfinden und Definieren vom Eigentum der Personen, Raub zusätzlich die Würde des Menschen, da diese oft mit Gewalt verbunden ist. Bestechung verletzt das Prinzip der Ehrlichkeit und der Verantwortung vor derselben. Schwarzarbeit verletzt die Ehrlichkeit, Ausbeutung verletzt ebenfalls die Würde mehrerer Menschen, jedoch über einen längeren Zeitraum und oftmals generationenübergreifend0.
Fernab der staatlichen Konsequenzen bei illegalen Aktivitäten, gibt es dennoch eine innere Barriere, bestehend aus Moral und damit automatisch verbunden, der Vernunft eines Menschen, gebündelt im Verstand, die erst überwunden werden müssen, um überhaupt diese Handlungen auszuführen. Nach eigener Definition beschreibt die Moral dabei nicht nur die Sitten und Verhaltensvorstellungen der Gesellschaft, sondern auch die jeweils eigenen Vorstellungen und angenommenen Normen. Nach eigener Auffassung und Kants Definition1 ist die Vernunft des Menschen dabei die Fähigkeit zur Erkennung gegebener Verhältnisse und Strukturen und diese in Verbindung zu setzen, wobei beides im Verstand mündet, welcher aus diesen beiden Komponenten die gegebenen Informationen abwägt und Urteile bildet. Diese einzelnen Aspekte verleiten uns auf der rationalen Ebene zu unserem Handeln und ebenfalls, nur auf diese Aspekte bezogen, zu moralischem und sittlichen Handeln, wodurch in irgendeiner Form eine illegitime Aktion automatisch erkannt und stigmatisiert werden würde. Jedoch handelt ein jeder Mensch, wie auch ich selbst, nicht nur auf der Grundlage rationaler Beurteilungen, sondern auch aufgrund von Gelüsten und Trieben. In diesem Falle wäre es der Wunsch nach Wertgegenständen und Geld, im extremsten Falle der Geldgier. Somit steht der präfrontale Kortex unseres Gehirns, in dem das rationale Denken stattfindet, gegen das limbische System, in welchem unsere Gefühle und Gelüste verarbeitet werden.
Diese einzelnen Bereiche unseres Wesens stehen oftmals im Gegensatz zueinander. Zur Verdeutlichung dieses Prinzips kann in diesem Fall das Modell von Sigmund Freud angewendet werden. Er unterscheidet den Menschen in das „Es“, das „Über-Ich“ und das „Ich“. Das Es beschreibt dabei unsere Instinkte, Gelüste und Emotionen. Das Über-Ich stellt das rationale Denken, Vernunft und Verstand, dar. Das Ich stellt dann ebenfalls die Balance zwischen diesen beiden Bereichen dar. Das Ich muss zwischen den beiden Bereichen des Seins abwägen, um sowohl die Bedürfnisse zu befriedigen als auch dabei rational und wohlüberlegt zu handeln. Um ein Beispiel, bezogen aufs Geld zu bringen: Wenn wir uns unbedingt das neueste technische Produkt (Smartphone) wünschen und es uns kaufen wollen, das Es somit einen Handlungswunsch äußert, realisiert das Über-Ich den Preis, die aktuelle finanzielle Situation und die Haltbarkeit und den Zustand der bisherigen technischen Ausrüstung. Somit kann das Über-Ich auch zu dem Schluss kommen, dass ein Kauf unmöglich oder unnötig ist. Bei diesen Gegensätzen zwischen beiden Bereichen muss das Ich eine Entscheidung fällen. In diesem Fall würde es so ausfallen, dass sich das technische Produkt bei besserer finanzieller Situation und der Notwendigkeit des Produktes gekauft wird. Damit wären sowohl das Es als auch das Über-Ich befriedigt und es ist ein vernünftiger Weg, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Dies ist die grundlegendste Überlegung des Menschen, bei dem der Verstand vernünftig verwendet wird.
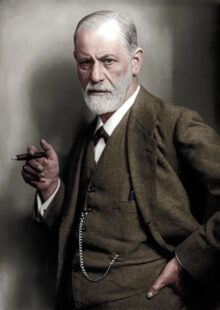
Sigmund Freud (1856-1939), Arzt und Begründer der Psychoanalyse
Gleichwohl ergibt sich dadurch kein Anhaltspunkt für eine Erklärung der doch sehr zahlreichen Delikte, allein in Deutschland 2020 210.000 Raubdelikte, einer sechsstelligen Dunkelziffer für Diebstahldelikte und 650.000 Wettbewerbs-, Korruptions- und Amtsdelikte2, welche alle auf unterschiedliche Weise mit der Selbstbereicherung verbunden sind. Alle Modelle, sowohl von Sigmund Freud als auch von Kant und antiken Vorbildern, würden an sich im Ansatz bereits diesem unmoralischen Verhalten, nicht nur zur Selbstbereicherung, sondern generell, widersprechen. Kants kategorischer Imperativ in der Grundformel „Handle so, dass die Maxime deiner Handlungen zum allgemeinen Gesetz werden kann“, würde alle illegitimen Handlungen zur Selbstbereicherung negieren. Die Maxime der Handlung, also der Wille, der hinter dieser Handlung steckt, wäre die Selbstbereicherung. Da die Maxime der Handlung erst geprüft werden muss und zwar mit den moralischen Werten und der vernünftigen Verallgemeinerbarkeit, kann es nicht gewollt sein, dass sich alle Personen nach der Maxime „Ich tue alles, um mich selbst zu bereichern“, verhalten. Selbst der Hedonismus nach Epikur, welcher genussorientiert ist und somit dem Wunsch der Selbstbereicherung am ehesten nachkommen würde, ist dennoch auf eine gewisse Kontrolle und Balance ausgelegt für das geistige und körperliche Maß und würde, auch im Kontakt mit anderen Menschen, der absoluten Selbstbereicherung mit allen Mitteln widersprechen. Somit gibt es, gemessen an den drei unterschiedlichen Theorieansätzen, welche unterschiedlich stark das Individuum und das gesellschaftliche Leben in den Fokus setzen, keine vernünftige Begründung für den ausgelebten Wunsch der Selbstbereicherung, speziell durch illegitime Handlungen.
Dennoch ist der Einfluss des Geldes auf das menschliche Verhalten vorhanden. Da jeder Mensch in der Lage ist, sich seines Verstandes zu bedienen, sofern er nicht geistig eingeschränkt ist, sollte er in der Lage sein, selbst einfache vernünftige und moralische Überlegungen und Reflexionen bezüglich der eigenen Handlungen anzustellen. Wie ist es also möglich, dass Selbstbereicherung und insgesamt das Geld ein ausreichender Faktor für viele Menschen ist, sodass es sie dazu verführen kann, ihre innere Barriere eigener Moral- und Handlungsvorstellungen zu überwinden und entsprechend Verstand wie Vernunft zu kompromittieren?
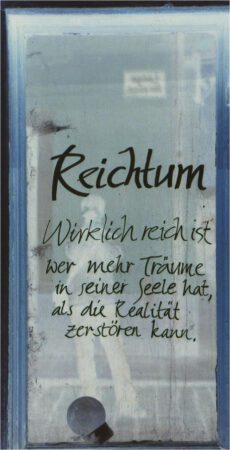
Dafür schaue ich mir verschiedene Schichten, Personen und deren tendenzielle Verstöße gegen die Moral an. Arme sind Personen, die unterhalb oder an der Armutsgrenze leben und rund 1.000 Euro netto monatlich verdienen. Reiche sind Personen, die deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt leben und mindestens 10.000 Euro netto pro Monat verdienen. Ärmere Personen neigen eher zu Diebstählen und Raub, da sie sich die teuersten Wertgegenstände nicht selbst erwirtschaften können. Selbst wenn viele dieser Straftaten aus dem Affekt heraus entstehen, sind dennoch viele Überfälle, speziell auf Banken und Villen, oft über Monate minutiös geplant. Kurzum, der Verstand und die Vernunft werden für illegitimes Handeln verwendet, trotz der großen Planungszeit und der damit gegebenen Möglichkeit zum ausführlichen Nachdenken über die Handlung. Meinem Verständnis nach würde diese Zeit ausreichen, um selbst in der Notlage die moralische Unmöglichkeit des Vorhabens zu erkennen und dementsprechend vielleicht Alternativen, auch von staatlicher Seite, zu suchen. Auffällig ist jedoch, dass überfallene Personen aus einer deutlich höheren sozialen Schicht kommen als die Täter. Meiner Meinung nach bewirkt die verdrehte Moral, dass diese Täter denken, ein Sinn der Gerechtigkeit stehe dahinter. Der Gedanke dominiert, dass die Geschädigten zu viel Geld und Wertgegenstände besitzen, wodurch eine Erleichterung derselben zugunsten ihrer selbst, welche deutlich weniger Kapital besitzen, vertretbar wäre. Man würde diesen Personen ja nicht wirklich schädigen und die Gerechtigkeit, welche auch in Hass umschlagen kann, würde darin bestehen, dass die Armen etwas bekommen und die angesprochene Spaltung der Gesellschaft nach Arm und Reich durch diese illegitime Handlung per Eigeninitiative gemildert werden soll. Dies sind jedoch nach moralischen Maßstäben eine Irreführung und Fehlinterpretation sowie ein Missbrauch der Gerechtigkeit, da dieser Begriff sich nicht auf die gleiche Einkommensverteilung bezieht und nicht als Begründung dafür angeführt werden kann. Doch mit dieser Begründung ist der Verstand dazu verwendet worden.
Der Verstand und die Moral werden verbogen, durch bewusstes Einreden solcher Verfehlungen außer Kraft gesetzt und zur Legitimierung der eigenen egoistischen Handlungen verwendet. Das Verhalten wird in dieser Situation vom Geld, dem Wunsch der Selbstbereicherung, bestimmt, denn, nur weil eine unmoralische Handlung von einem Menschen ausgeführt wird, bedeutet das nicht, dass dieser Mensch an sich unmoralisch ist. Oftmals ist es so, dass Personen nie durch illegitime Handlungen aufgefallen sind und erst durch den Wunsch der Selbstbereicherung moralisch versagen.
Schauen wir uns allerdings auch die reichen Personen an. Obwohl diese an sich genug Geld für mein Verständnis besitzen und dementsprechend einen bereits hohen Lebensstandard erreicht haben, begehen sie ebenfalls ökonomisch illegitime Handlungen. Beispiele dafür sind Korruption, Bestechung, Ausbeutung und Schwarzarbeit. Es fällt mir schwer, mich in die potenziellen Gedanken und Gefühle dieser Personen hineinzuversetzen, die an sich bereits viel Macht und Geld besitzen, welches bereits für ein privilegiertes Leben ausreicht. Da jedoch dieses Leben an das Geld gebunden ist, sind die Personen auch abhängig von demselben. Um also den Lebensstandrad beizubehalten oder gar noch zu erhöhen, werden ebenfalls illegitime Handlungen ausgeführt. Ich beziehe mich im Folgenden auf das Handlungsbeispiel der Ausbeutung. Ausbeutung beschreibt den Beschäftigungszustand der Arbeiter, bei dem sie keinerlei Versicherungen haben, das Gehalt selbst für die Verhältnisse des Landes nicht zum Decken der Grundbedürfnisse reicht und der Einsatz der Arbeit nur mit gesundheitlichen Schäden und mitunter durch Kinderarbeit erzielt wird. Vor allem Firmenkonzerne oder deren Subunternehmen, welche stets die Betriebe auch in fernen Ländern, in denen sie produzieren, überprüfen und Gehälter auszahlen, wissen von den Arbeitsbedingungen, die sie selbst durch fehlende Investitionen hervorrufen. Auch dies tun sie bewusst, obwohl die finanziellen Mittel in den größten Konzernen vorhanden wären.

Zuerst sei gesagt, dass Studien, wenn auch nur auf Deutschland 2012 bezogen, gezeigt haben, dass Personen, die zur Elite der Gesellschaft gehören, soziale Unterschiede als „weitaus unproblematischer ansehen als die Bevölkerung insgesamt und Maßnahmen zu ihrer Reduzierung dementsprechend häufiger ablehnen“3. Da die Gesellschaften der westlichen Kulturen sich zumindest ähneln, kann dies auf diese übertragen werden. Kurzum, die Eliten, welche nach dem gesellschaftlichen Status zu den Reichen gehören, sind insgesamt weniger sensibel für die sozialen Unterschiede und, generell, weniger empathisch für die Probleme der ärmeren Personen. Der egoistische Teil des Charakters ist tendenziell stärker ausgeprägt. Da zudem diese Personen nicht im direkten Kontakt aus anderen Schichten kommen, da auch an sich die Eliten eher unter sich bleiben. Empathie ist eher wenig vorhanden und die Menschen, die hinter den Erfolgszahlen der Firma stehen, werden vielleicht nicht als Menschen gesehen, sondern nur als Generierende des Erfolgs.
 Zeit ist Geld und Geld ist Macht
Zeit ist Geld und Geld ist Macht
Indem die Menschen materialisiert werden und auch die Erziehung und Mentalität der Reichen und Mächtigen auf den Profit ausgelegt ist, werden die gesamtgesellschaftlichen Normen nicht anerkannt, abgeschwächt und der höher positionierte Egoismus sorgt dafür, dass alle Maßnahmen als vernünftig angesehen werden, um eben die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das Prinzip des „geldheckend[en] Geld[es]“4 findet hier Anwendung. Denn, wie bereits Marx sagte, es wird Geld investiert, um Waren zu erzeugen, diese zu verkaufen und dadurch mehr Geld zu generieren als investiert wurde. Dieser Grundgedanke der Kapitalisten sorgt dafür, zusammen mit einer abgeschwächten Moral zum Verwenden des Verstandes, der diese illegitimen Handlungen koordiniert und in ihnen selbst kein Fehlverhalten sieht. Moral wird erneut uminterpretiert, bis der Verstand und die Vernunft außer Kraft gesetzt werden sind.
Kommen wir zuletzt zu mir. Ich selbst sehe mich, aufgrund der finanziellen Situation meiner Familie im Mittelstand. Ich selbst habe kein Bedürfnis, mich durch Diebstahl, Ausbeutung oder ähnliche Handlungen zu bereichern. Dennoch unterstütze ich indirekt Ausbeutung und somit illegitime Handlungen. Ich selbst habe jetzt bereits in diesem Essay die Ausbeutung von Firmen wie beispielsweise Apple kurz angeschnitten, bin mir also sehr wohl bewusst, dass Firmen, nicht nur in der Technikbranche, sondern auch beispielsweise in der Kleidungsindustrie, dies betreiben. Dennoch kaufe ich Produkte, auch im Preis- und Qualitätsvergleich, die von Firmen stammen, die auch nach meiner eigenen Definition Ausbeutung betreiben. Somit versuche ich zwar nicht selbst, mich zu bereichern, unterstütze jedoch die Bereicherung von Ausbeutern und dies ebenfalls bewusst. Gleichzeitig ziehe auch ich als Konsumentin die Variante eines Produktes vor, bei dem ich so wenig Geld wie möglich ausgeben muss. Ich unterstütze somit, bewusst mit meinem Verstand und meiner Vernunft, indirekt Ausbeutung durch den Kauf der Produkte, da ich mir selbst beim Kauf nicht die Moral ins Gedächtnis rufe, nur geldorientiert handle und mich an den Produkten indirekt bereichere. Somit blende ich die Menschen, die hinter dem Produkt stehen, aus und der Wunsch der Bereicherung am Produkt mit dem Geld steht im Vordergrund.
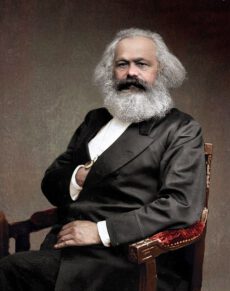
Karl Marx (1818-1883), philosopher and German politician. (Photo by Roger Viollet Collection/Getty Images)
Insgesamt hat das Geld in unseren westlichen Gesellschaften einen zu hohen Stellenwert und ist daher in der Lage, unseren Verstand, unsere Vernunft und unsere Moral zu verdrehen, zu unterwandern und für die Selbstbereicherung zu verwenden, ohne ein „schlechtes Gewissen“ zu haben. Umso wichtiger ist es, sein eigenes Verhalten stets im Umgang mit Geld zu reflektieren, um sich nicht von dem Gedanken an Geld beherrschen zu lassen und sein Verhalten moralisch vernünftig zu begründen und auszuführen.
Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Quellen:
0) https://www.lernen.net/artikel/werte-16618/
1) http://www.philolex.de/vernunft.htm
2) https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikationen/themen/sicherheit/pks-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=2
3) Michael Hartmann „Soziale Ungleichheit – Kein Thema für Eliten?“ im Campus Verlag 2013, auszugsweise: „Eliten in Deutschland: weiß, männlich, bürgerlich – und westdeutsch…“
Die Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung zum
11. HCG-Philo-Wettbewerb 2021/22
Das Geld

Das Schatzhaus der Athener in Delphi
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So werden bevorzugt Themen gestellt, die entweder sehr aktuell sind oder im Interessenhorizont vieler Schülerinnen und Schüler liegen. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc. Das Thema wird jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.
Ausschreibungstermin ist jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtsferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturienten noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner/innen-Produkt erfolgt am 22. April, Kants Geburtstag. Urkunden und Preise werden dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer*innen.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 11. HCG-Philo-Wettbewerb 2021/22:
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Das Geld“
Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion über das Geld. Meistens fehlt es, ansonsten spricht man nicht darüber. „Geld regiert die Welt“, sagt der Volksmund. Oder: „Geld stinkt“, aber auch: „Geld stinkt nicht“. „Beim Geld endet die Freundschaft“. Und: „Zeit ist Geld“. „Alles in der Welt“, sagt Kant, „hat entweder einen Preis oder eine Würde.“ Soll heißen: nicht alles ist bezahlbar. Michael Sandel schrieb ein Buch mit vielen Beispielen dazu: „Was man für Geld nicht kaufen kann“.
Was ist Geld überhaupt? Welche Rolle spielt es in unserem Leben? Wieviel brauchen wir davon? Wozu sollten wir es am besten ausgeben? Wie hängt es mit Politik und Gesellschaft zusammen? Macht Geld eigentlich glücklich? „Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück, ich brauche nur Musik, Musik, Musik“, bekannte ein alter Schlager. Und gab uns Mariann’chen nicht zu bedenken: „Wären Tränen aus Gold und Sorgen aus Silber, wer wünschte da noch, reich zu sein; denn wer tauschte alles Gold und alles Silber gegen Liebe ein?“ Warum streben dann fast alle danach? Ist es etwa mit einem Gott vergleichbar? Fragen über Fragen, ganz grundsätzlicher Art! Die eine oder andere davon könntest du in deinem Essay beantworten.
Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie du das Thema angehst: Religionsphilosophisch, gesellschaftskritisch, ethisch, anthropologisch, neuro-philosophisch – unter dem Stichwort „neuroeconomics“ verweist uns Google auf sage und schreibe 472 000 Seiten – oder staatstheoretisch. Der Sozialphilosoph Karl Marx, Begründer des Marxismus, widmete sein Hauptwerk „Das Kapital“ diesem Thema. Nach ihm schrieb der Lebensphilosoph Georg Simmel eine „Philosophie des Geldes“, ebenso Christoph Türcke unter dem Titel „Mehr!“. Heute gibt es sogar die Theorie des „Geld-Gehirns“.
Wie beurteilst du die Bedeutung des Geldes? Du kannst „frei“ und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du das Thema in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, die zur Orientierung im Leben beitragen können. (Philosophieren heißt schließlich, sich in Grundfragen des Denkens, Lebens und Handelns zu orientieren.)
Dein Text soll maximal 4 Computer geschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangs-Stufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisch-begriffliches (nicht nur fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität.
Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays oder anderen Beitrags über „Das Geld“!
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
11. HCG-Philo-Wettbewerb 2021/22
Ausschreibung: Am 18.11.2021, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und 9. wie 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays zum Thema „Das Geld“.
Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Einsendeschluss: Am 12.02.2022 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/in: Am 22.04.2022 (Kants Geburtstag)
Preis: Ehrung, Bücher und Urkunden für die drei besten Texte
Was ist ein guter philosophischer Essay?
Herzlichen Glückwunsch!

22.04.2021 (Kants Geburtstag): Königsberg meldet Entscheidung im 10. HCG-Philo-Wettbewerb!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Jury der Philosophie-Lehrer*innen hat den 10. HCG-Philo-Wettbewerb entschieden! Unter den 73 eingesendeten Texten (der Rekord von 74 im letzten Jahr wird nur knapp verfehlt) zum Thema „Wie frei sind wir wirklich?“ wurden als beste ausgewählt die Essays von
Charleen Hartmann (4. Semester) : 1. Preis
Lisa Hahn (10. Jahrgang) : 2. Preis
Charlotte Heidelbach (2. Semester) : 3. Preis
Lily Krusche (9c) : Sonderpreis
Philos und seine Freunde, allen voran Herr Rußbült und die Philosophie-Lehrer*innen des HCG, gratulieren ganz herzlich!
Die Preisverleihung soll noch vor den Sommerferien, entweder am 22. oder 23. Juni stattfinden.
Ich bedanke mich vielmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die äußerst gehaltvollen und sehr anregenden Texte. Bis zur Ausschreibung des 11. HCG-Philo-Wettbewerbs am 18.11.2021, dem UNESCO-Welttag der Philosophie!
Dr. Ulrich Müller Berlin, den 22.04.2021
Hier lesen Sie die prämierten Essays:
1. Preis
Charleen Hartmann:
Das Ass im Ärmel des bewussten freien Willens
Wie frei sind wir wirklich? Eine berauschende philosophische Frage, die verschiedenste Komponenten enthält. Doch bevor wir mit dieser philosophischen Reise beginnen, müssen wir erstmal eine Route und ein Schiff auswählen, denn das Meer ist groß und nicht nur ein Weg führt zu einer Antwort. Also definieren wir die Rahmenbedingungen. Das Subjekt dieser Frage ,,wir” definiere ich wie Kant als zur Vernunft fähiges Wesen, den Menschen. Wenn wir von der Wirklichkeit reden, dann suchen wir nach der Wahrheit. Letztlich müssen wir den abstrakten Begriff der Freiheit eingrenzen. In dem folgendem Text werden wir uns mit der theoretischen Freiheit im naturwissenschaftlichen Sinne befassen. Unsere Reise handelt von der Willensfreiheit des Menschen. Der Mensch sei dazu fähig, aus eigenem Willen autonom, ohne Abhängigkeit oder Zwänge, Entscheidungen zu treffen. Inwiefern der willensfreie Mensch auch die Handlungsfreiheit hat seine theoretischen Entscheidungen praktisch umzusetzen, ist ein weitere Frage. Aber sicher ist, wenn der Mensch keine freien theoretischen Entscheidungen treffen kann, dann kann er diese auch nicht praktisch umsetzen. Da die Willensfreiheit somit die Handlungsfreiheit in gewissem Maße bedingt, widme ich der Willensfreiheit dieses Essay.
Anfang des 18. Jahrhunderts stellte sich der Philosoph Arthur Schopenhauer diese provokative Frage: ,,Kann ich wollen, was ich will?” Provokativ, weil diese Frage viele philosophische Theorien über den Menschen und sein Handeln über den Haufen schmeißen könnte, würde jemand meinen, dass wir nicht wollen können, was wir wollen. Klingt vielleicht ein wenig kompliziert. Gemeint ist: Wenn wir nicht wollen können, was wir wollen, dann sind es nicht wir selbst, die unseren Willen führen. Unser Wille wäre unfrei und wir könnten Entscheidungen nicht selbst treffen. Wenn unser Wille unfrei wäre, dann würden sich Philosophen wie Immanuel Kant ziemlich ärgern. Kant war der Meinung, dass unser Wille durch unseren Verstand und unsere Vernunft gelenkt werde. Er definiert sogar den Menschen als Vernunftwesen. Genau die Vernunft sei das Besondere an unserer Art. Wenn unsere Vernunft nun gar nichts gegen unseren Willen in der Hand hat, dann wären Kants und viele andere philosophischen Theorien zum Scheitern verurteilt.
Doch bevor wir diesen dunklen Pfad in die Ontologie gehen und unser Sein bezweifeln, schauen wir uns eine optimistische Meinung an: den Existentialismus. Die philosophische Theorie, welche die absolute Freiheit des Einzelnen unterstützt. Der französische Philosoph und Hauptvertreter des Existentialismus Jean-Paul Sartre würde zu unserer Leitfrage also sagen, dass jeder Mensche frei sei, das zu tun, was er wolle. Und zu Schopenhauer würde er sagen, dass der Wille des Menschen frei von äußeren (gesellschaftlichen) und inneren (psychischen) Zwängen sei. Diese absolute Freiheit entspringt der Vorstellung, dass der Mensch nichts sei, bevor er sich nicht selbst entwerfe. Der Mensch ist das einzige Tier, das sich mit dem beschäftigen könne, was nicht existiert. Der Mensch kann lügen. Durch diese enorme Vorstellungskraft könne der Mensch sich so planen, wie er möchte und seinen Willen frei danach ausrichten. Wir Menschen haben nach Sartre, die Freiheit in allen Bezügen des Seins und somit auch als einziges Lebewesen einen absolut freien Willen. Also können wir doch wollen, was wir wollen, weil wir unsere Willen frei nach uns selber gestalten. Das ist mal eine Antwort, die man gerne hört. Kant wäre erleichtert.
Doch sind wir Menschen wirklich eine Tabula rasa, welche wir selbst bemalen können, wie wir es wollen? Kant selbst schrieb, dass wir Menschen aus krummem Holz geschnitten seien. Wir sind keine leere Tafel, schon allein durch unsere evolutionsbedingten Triebe und Gefühle müsste diese Tafel bunt sein. Von Instinkten und Wünschen sind wir und unser Wille nicht frei. Und wenn wir uns absolut frei gestalten könnten, wieso ähneln wir Menschen als Art so sehr? Diese absolute Willensfreiheit ist in unserer Welt, welche durch Tradition, Normen und Konformität geprägt ist, nicht zusehen. Realistisch erscheint mir Sartres Meinung also nicht.
 Kommen wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt oder bringen wir genetische Anlagen mit? Dies scheint sich Sibylle auf dem Bild von Velasquez zu fragen.
Kommen wir als unbeschriebenes Blatt auf die Welt oder bringen wir genetische Anlagen mit? Dies scheint sich Sibylle auf dem Bild von Velasquez zu fragen.
Ziehen wir nun doch wieder die dunklere Seite des Spektrums in Betracht. Viele Hirnforscher sagen, dass wir Menschen genau durch diese unterbewussten inneren Zwänge wie Wünsche, Sehnsüchte und Instinkte unfrei seien. Hirnforscher Gerhard Roth ist der Meinung, dass wir unser Bewusstsein erheblich überschätzen. Damit meint er nicht nur die Größe unseres Bewusstsein im Vergleich zu unserem Unterbewusstsein, welche schon von Sigmund Freud als Eisberg im Meer dargestellt wurde: Das Bewusstsein sei die kleine sichtbare Spitze des Eisberges und das Unterbewusstsein der riesengroße Rest des Eisberges, der unter dem Meeresspiegel versteckt sei. Roth meint, dass wir die Macht unseres Bewusstseins über unseren Willen überschätzen würden. Der Herr unseres Willens sei unser Unterbewusstsein. Da die inneren Zwänge des Unterbewusstseins nicht kontrollierbar und somit unfrei seien, wäre auch unser Wille unfrei. Aus der neurobiologischen Sicht würde die endgültige Entscheidung nämlich nicht von unserem präfrontalen Cortex, wo unser Verstand haust, entschlossen werden, sondern von unserem limbischen System. Dieses reguliert das Affekt- und Triebverhalten. Sensorische Informationen werden im Limbischen System organisiert und emotional beantwortet. Wir Menschen würden uns dann dafür das entscheiden, was als emotional akzeptabel gelte und der Verstand sei einzig und allein ein Hilfsmittel.
Würde Schopenhauer heutzutage leben, wäre er bestimmt ein Neurologe geworden, so sehr würden ihn Roths Theorien erfreuen. Ihre Ansichten über unsere nicht vorhandene Willensfreiheit sind sehr ähnlich. Der kleine Unterschied der existiert, handelt von dem Verstand. Statt den Verstand als Hilfsmittel zu sehen, verleiht Schopenhauer dem Verstand eine noch schlechtere Position. Die Position des Rechtfertiger. Unser unfreie Wille sagt uns was zu tun sei, bevor der Verstand es überhaupt wisse und erst danach würden wir den Verstand nutzen, damit er sich um jegliche Zweifel kümmert. Schopenhauer antwortet auf seine Frage ganz klar mit, wir können nicht wollen, was wir wollen! Der Wille des Menschen sei unfrei.
In den 1980ger Jahren kreiste dann ein neues empirisches Experiment im internationalen philosophischen Raum: Das Libet Experiment. Benjamin Libet versuchte den Zusammenhang zwischen einer Handlung und dem dazugehörigen Willensakt empirisch nachzuweisen. Er setzte eine Frau auf einen Stuhl vor eine Uhr und verband das erste Kabel um das Handgelenk der Patientin und das zweite an einem Helm an ihrem Kopf mit einem Messgerät, um ihre motorischen und neuronalen Vorgänge messen zu können. Die Frau sollte auf die Uhr schauen und an einem bestimmten frei gewählten Punkt ihren Arm heben. Die Ergebnisse waren erstaunlich. 550 Millisekunden vor der Ausführung der Bewegung meldete sich schon das Bereitschaftspotential zur Bewegung, während der Willensakt, also der bewusste Entschluss sich zu bewegen, nur 200 Millisekunden vor der Bewegung stattfand. Libet interpretierte diese Werte so, dass neuronale Prozesse im Gehirn eine Bewegung oder Entscheidung einleiten , bevor der Mensch sich darüber überhaupt bewusst ist. Viele
Wissenschaftler waren somit entschlossen, dass Entscheidungen nicht bewusst von unserem Verstand getroffen werden würden, sondern von unbewussten Hirnprozessen. Somit würden wir über keine bewusste Willensfreiheit verfügen. Libet selbst schloss aber die Willensfreiheit nie aus. Libet erweiterte sein Experiment und fragte die Frau, so spät wie möglich ihre vorbereitete Bewegung zu unterbrechen. Die Messgeräte zeigten, dass dies bis zu 100 Millisekunden vor der Bewegung möglich war und es trotzdem 450 Millisekunden vorher ein unbewusstes Bereitschaftspotential gab, die Bewegung auszuführen. Daraus schloss Libet, dass wir Menschen unseren unbewussten Willensakt (das Bereitschaftspotential) bewusst stoppen konnten. Libet nannte dies die Vetofunktion. Der Mensch habe keinen freien Willen, aber einen freien Unwillen. Oder anders verfasst: Wir besäßen eine unbewusste Unfreiheit und eine bewusste Freiheit, wenn es um unseren Willen geht.
Nach diesem wilden Sturm von Meinungen und Fakten und alles dazwischen ist die Sicht wieder klar und wir können schon langsam unsere Destination sehen. Stellen wir uns erneut der Frage: Wie frei ist unser Wille und somit wir selbst wirklich? Ist unser Wille absolut frei, wie es Sartre meint, oder ist Willensfreiheit nur eine Illusion, wie es Schopenhauer und Roth meinen? Ich stimme am meisten mit Libets Interpretation zu. Auch wenn es methodische und theoretische Einwände gegenüber dem Experiment gibt. Der Wille ist unfrei, aber der Unwille ist frei. Roth hat wahrscheinlich recht damit, dass unser Wille hauptsächlich von unbewussten inneren Zwängen getrieben ist, welche schon, bevor wir es wissen, ein neuronales Bereitschaftspotential auslösen können. Dadurch sind wir Menschen von einer unbewussten Unfreiheit geprägt. Aber unser Wille wird nicht allein von Emotionen und Trieben kontrolliert. Sonst wären altruistische und vernünftige Entscheidungen wohl viel seltener. Der Verstand muss eine größere Rolle spielen, als sie ihm Schopenhauer zuwies. Der Verstand kann nicht nur zur Rechtfertigung bedingt sein.
Schauen wir uns ein Beispiel an. Eine vollschlanke Frau, nennen wir sie Bianca, hat einem Arzttermin, bei welchem sie erfährt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen abnehmen muss. Bei diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass Bianca die volle Handlungsfreiheit hat, ihre Entscheidungen umzusetzen. Die Frau setzt sich das Ziel schnell abzunehmen und verzichtet auf mehrere Mahlzeiten am Tag. Erst beim Abendessen isst sie etwas. Doch sie kann ihren nun emotionalen Hunger nicht mehr bändigen und isst viel mehr zum Abendessen, als sie sich hätte erlauben wollen. Aber sie kann sich nicht ,,zur Vernunft bringen”. Sie bekommt ein schlechtes Gewissen, welches zeigt, dass der Verstand nicht nur zur Rechtfertigung bestimmt ist. Doch am nächsten Tag schafft sie es wieder, sich bewusst zu kontrollieren und verzichtet auf ein Frühstück und Mittagessen. Dieses Beispiel soll das Machtspiel zwischen den Wünschen des limbischen System (hier: nicht zu hungern) und den Wünschen des Verstandes (hier: abzunehmen) darstellen. Denn ein wichtiger Teil, welcher zur endgültige Entscheidung mitträgt, ist die Willenskraft. Es gibt verschiedene Willensimpulse. Es gibt den komplizierten Willen, wie der Wille das Ziel eines bestimmten Gewichtes zu erreichen, und es gibt simplere Willen, die eher kurzfristig und emotional sind, wie physischen und emotionalen Hunger zu stillen. Der erste Willensimpuls stammt aus dem präfrontalen Cortex, der letztere aus dem limbischen System. Das Machtspiel zwischen diesen zwei Willensimpulsen ist wie ein Kriegsspiel. Wer schießt zuerst? Der Wille zu essen ist natürlich aus guten überlebenswichtigen Gründen so stark. Dieser bei Bianca ungewollte Wille wird ihren bewussten Willen abzunehmen, zuerst beschießen. Biancas bewusster Wille abzunehmen wird sich durchgehend verteidigen müssen. Zurück zuschießen wird nicht viel bringen, denn unsere unbewussten biologische Triebe sind unfrei und können von uns nicht verändert werden. Nun steht Bianca vor ihrem Abendessen. Ihr unbewusste unfreier Wille schreit zuerst auf: Iss! Aber der bewusste freie Wille hat ein entscheidendes Ass im Ärmel: die Vetofunktion. Bianca kann sich also entscheiden, nicht auf den unbewussten unfreien Willen einzugehen. Deshalb wird der bewusste Willensakt, etwas nicht zu tun, auch freier Unwille genannt. Ob der Unwille und seine Vetofunktion stark genug sind, um sich gegen den Willen zurichten, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Bei Bianca wird es ein hin und her sein, da ihre Angehensweise, nichts zu essen oder alles auf einmal zu essen, sehr extrem ist. Deshalb ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen den unfreien Trieben und dem freien Verstand zu finden, sonst schadet man seiner mentalen und physischen Gesundheit. Wie der Kompromiss aussieht und welcher Willensimpulse stärker ist, ist von Situation zu Situation anders. Bianca entscheidet sich also dazu, auf keine Mahlzeit mehr zu verzichten, aber sich ausgewogen zu ernähren. Eine langfristiger Kompromiss zwischen unfreier Wille und freiem Unwillen.
 Der bewusste freie Wille hat ein entscheidendes Ass im Ärmel: die Vetofunktion
Der bewusste freie Wille hat ein entscheidendes Ass im Ärmel: die Vetofunktion
Es ist nicht selten, dass Menschen zwiegespalten sind, wenn es sich um Entscheidungen handelt. Es ist auch nicht selten, dass Menschen das Gefühl haben, sie seien fremdgesteuert. Man kann sich den freien Unwillen und seine Vetofunktion nicht wie die Vetofunktion der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorstellen, wo ein Veto jegliche Entscheidung blockieren kann. Die Vetofunktion des freien Unwillen ist nicht immer sicher oder verlässlich, doch sie kann entscheidend sein, je nachdem welcher Willensimpuls stärker ist. Kant hat recht: Wir sind zur Vernunft fähige Wesen. Aber nur weil wir diese Fähigkeit aufweisen, heißt das nicht, dass wir sie immer einsetzen können oder sollten. Unser unbewusste Wille ist zwar nicht frei, aber er ist für das Individuum lebensnotwendig.
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir durchaus eine bewusste relative Freiheit beim Entscheidungstreffen haben. Denn mit Freiheit kommt auch Verantwortung. Die negativen Konsequenzen, die entstehen würden, wenn keiner für seine Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden könnte, wären erheblich. Betrachten wir die derzeitige Corona Krise. Wir sind soziale Wesen und im Haus eingesperrt zu sein, ist nicht etwas, dass von uns gewünscht oder von unseren Instinkten geleitet wird. Unsere inneren Zwänge, welche unseren unbewussten Willen kontrollieren, würden den meisten Menschen sagen, sie sollen wieder mal raus gehen. Wenn unsere ganze Gesellschaft daran glauben würde, wir hätten nichts gegen unseren unfreien Willen in der Hand, dann könnte keiner, der eine große Feier organisiert und hunderte von Menschen einlädt und sie so gesundheitlich gefährdet und gegen die Regeln verstößt, verantwortlich gemacht werden. Man würde denken, die Person könne nichts gegen ihren unfreien Willen tun. Unsere Judikative wäre unnötig und unsere Demokratie hinfällig.
Nachdem uns die Wellen des Meeres auf dem Schiff hin und her gewippt haben, ist unser Schiff nun am Hafen angekommen. Hier erwartet euch meine Antwort zur Frage: Wie frei sind wir wirklich?
Unser Wille ist durch die inneren unbewussten Zwänge wie Triebe und Sehnsüchte unfrei. Aber unser Unwille ist so frei, wie der Willensimpuls und unser Glaube dem Verstand in jener Situation Stärke verleihen, sich gegen die inneren Zwänge durchzusetzen oder Kompromisse einzuleiten.
Quellen:
Amboss (2020). Verfügbar unter: https://www.amboss.com/de/wissen/Limbisches_System_und_Ged%C3%A4chtnis
Focus Online (2020). Verfügbar unter: https://www.focus.de/familie/wissenstest/philosophie-kant/was-ist-der-mensch-anthrop ologie_id_1751830.html
Lin-Hi, Nick & Suchanek, Andreas (2018). Verfügbar unter: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/freiheit-32648/version-256187
Pauen, Michael (2005). Verfügbar unter: http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit/aktuell/libet.html
Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Deutschland, München: Goldmann 2012, S. 146-156 & S. 313- 125.
2. Preis
Lisa Hahn:

Die eine große Freiheit gibt es nicht!
`Ich bin nicht frei` denke ich, als ich hier im Wohnzimmer sitze, aus dem Fenster gucke und versuche, diese philosophische Reflektion zu schreiben. Ich spüre, wie mein Kopf wehtut und der Unwille gegenüber dieser Aufgabe wächst. Ich will schlafen, doch das werde ich nicht. Ich nehme mir selbst die Freiheit davon weg. Wie idiotisch, nicht?
Da sitze ich nun hier, beschwere mich darüber, nicht frei zu sein, während andere Menschen auf dieser Welt noch viel weniger frei sind. Ein gemeiner Gedanke, der Schuld auf Schmerz legt – auch von ihm kann ich mich nicht befreien. Meine grausamsten Käfige sind mentaler Natur.
Gerade eben flog eine Krähe vorbei. Ist sie freier als ich? `Frei wie ein Vogel` sagt man doch immer. Aber sind Vögel denn wirklich frei? Was bedeutet es überhaupt, frei zu sein? Ich denke, vereinfacht gesagt, ist frei das Gegenteil von gefangen, bzw. gebunden. Daher kommt wahrscheinlich auch dieses Sprichwort: ein Vogel kann im Gegensatz zu uns nämlich fliegen und ist nicht an die Erde gebunden. Durch beispielsweise Flugzeuge haben wir da schon einen Fortschritt erzielt, doch so richtig überwinden werden wir diese Tatsache wohl nie. Wir können von selbst nicht fliegen. Wir werden immer an ein Flugzeug oder einen Fallschirm, etc. gebunden sein, wenn wir fliegen wollen. Wir sind diesbezüglich in unserer Handlungsfreiheit eingeschränkt.
Also ist der Vogel in dieser Hinsicht freier als wir. Aber dennoch würde ich ihn nicht als komplett frei bezeichnen, denn auch er ist an etwas gebunden: an die Gesetze der Natur. Käme nun ein Tornado, könnte er auch nicht mehr fliegen. Er ist gewissermaßen in seinem eigenen Körper gefangen, welcher ihn auch manchmal in seiner Handlungsfreiheit einschränkt. Gebunden, gefangen, eingeschränkt, nicht frei.
 Sind Vögel freier als wir?
Sind Vögel freier als wir?
Aber jetzt erstmal stopp. Was meine ich überhaupt plötzlich mit Handlungsfreiheit? Fangen wir von vorne an. Ich habe den Begriff Freiheit unterteilt, und zwar in Handlungsfreiheit und noch etwas Unerwähntem. Dieses bisher noch nicht Erwähnte ist die Willensfreiheit. Ich beziehe mich hier zum Teil auf den Professor für Philosophie Fernando Savater. Wobei ich den Begriff Freiheit jedoch nur in zwei (nicht drei wie Savater) Unterbegriffe aufteile: Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Handlungsfreiheit bedeutet, handeln zu können, wie man will und Willensfreiheit bedeutet, denken zu können, was man will.
Schön und gut, das klingt ja jetzt eigentlich ziemlich einfach, nur ist Freiheit leider kein ganz so simpler Begriff. Man kann ihn auch noch anders einteilen, sagen wir jetzt in psychische und physische Freiheit. Also jeweils ein uneingeschränkter mentaler und ein uneingeschränkter körperlicher Zustand. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass körperliche und mentale Gesundheit ein Stück Freiheit sind. Zur Verdeutlichung: Menschen im Rollstuhl sind in ihrer Handlungsfreiheit stärker beschränkt als jemand, der auch laufen und rennen und herumspringen kann.
Außerdem kann man Freiheit auch noch in positive und negative Freiheit einteilen, darauf gehe ich jetzt jedoch nicht weiter ein. Wichtig ist, dass frei ein komplizierter Begriff ist, jedoch grob gesagt mit uneingeschränkt, nicht eingesperrt gleichzusetzen ist. Freiheit ist also eine Wertung. Der Begriff bewertet, wie uneingeschränkt man ist.
Uneingeschränkt. Wer ist schon komplett uneingeschränkt? Sind wir komplett uneingeschränkt? Mit wir werde ich mich in dieser Reflektion auf die Menschen als verschiedene Individuen beziehen. Inwiefern sind wir einzelnen Menschen frei? Was schränkt uns ein, etc. Also ist meine Frage `wie frei sind wir Menschen individuell wirklich?`
Und jetzt noch dieses eine Wort, das ebenfalls definiert werden muss, damit die Frage zufriedenstellend beantwortet werden kann. `Wirklich`. Was ist damit gemeint? Was ist unsere Wirklichkeit? Nun ja, ich würde sagen, dass unsere Wirklichkeit nicht die wahre Wirklichkeit ist, da unsere Sinne gar nicht gut genug sind, um sie in ihrem vollen Ausmaß zu erkennen. Das scheint jetzt verwirrend, also hier die Erklärung: für uns ist wirklich, was wir wahrnehmen. Und wie nehmen wir etwas wahr? Mit unseren Sinnen. Nehmen wir jetzt beispielsweise mal das Auge. Wir sehen die Welt in einem bestimmten Farbspektrum, mit einem gewissermaßen starken Sehsinn. So nehmen wir unsere Außenwelt war, das errichtet einen Teil unserer Wirklichkeit. Doch jetzt gibt es zum Beispiel Raubvögel, welche fast zehn Mal so viele Sehzellen im Auge haben wie wir Menschen und somit auch einen stärker ausgeprägten Sehsinn. Oder aber haben Katzen eine sehr gute Nachtsicht, während die Nacht für uns meist nur sehr dunkel erscheint. Wie etwas ist und wie wir etwas wahrnehmen sind also zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Wir nehmen immer nur ein Bruchstück von der wahren Realität um uns herum wahr, können gar nicht alles objektiv wahrnehmen und somit ist unsere Wirklichkeit subjektiv und keinesfalls ein echter wissenschaftlicher Fakt. Unsere subjektive Wirklichkeit ist eine Art Abwandlung der objektiven, für uns nicht komplett wahrnehmbaren Wirklichkeit. Unsere Wirklichkeit könnte man also schon fast als eine halbe Täuschung ansehen, während die echte Wirklichkeit für uns nun mal nicht wahrzunehmen ist. Ich werde probieren, die Frage `wie frei sind wir wirklich?` jetzt sowohl in Hinsicht auf unsere subjektive als auch auf die objektive Wirklichkeit zu beantworten.
Aber jetzt erstmal zurück zum Hauptthema, der Freiheit. Gibt es sowas wie die Freiheit überhaupt? Es ist offensichtlich, dass wir verschiedene Freiheiten haben. Mir steht es im Moment beispielsweise frei, zu denken, was ich will. Wir haben auch eine fast komplett uneingeschränkte Meinungsfreiheit, zumindest hier in Deutschland (nur fast komplett uneingeschränkt, da es ja immer persönliche Gründe oder Ausnahmen geben kann, die einen zurückhalten und die Meinung im Kopf hinter Gitter schließen). Man kann Freiheit wie oben auch schon erwähnt in viele Unterkategorien einteilen: Handlungsfreiheit, Willensfreiheit, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Religionsfreiheit, … und so könnte man sie auch zu einer allgemeinen Freiheit zusammenfassen. Einen Zustand, in dem man komplett uneingeschränkt ist, komplett frei. Könnte man. Könnte. In der Theorie geht Vieles, aber gibt es so einen Zustand überhaupt? Meine Antwort darauf ist eindeutig nein. Wenn man es objektiv betrachtet, wird es sowas für keinen Menschen in unserer Welt jemals geben. Letztendlich ist man immer an mindestens zwei Dinge gebunden: die Gesetze der Natur und somit auch an den eigenen Körper. Manche Sachen sind für Menschen (sagen wir jetzt mal hundert Salti vom 10-Meter Brett auf einmal machen) einfach unmöglich und man wird nie die Freiheit besitzen, diese Sachen auszuführen. Ich glaube aber auch allgemein, dass es so einen Zustand nicht gibt, da Freiheit in sich selbst gesehen schon manchmal paradox sein kann. Damit meine ich, dass einige Freiheiten andere wegnehmen. Klingt unlogisch und kompliziert, oder? Hier ist ein Beispiel: Sagen wir, ich bin frei hinzugehen, wo auch immer ich hinwill. Ich kann also morgen nach Leipzig gehen oder nach Köln oder an die Ostsee oder nach Amerika oder in die Karibik, etc. Wenn ich mich jetzt frei dazu entscheide, nach Leipzig zu gehen, verliere ich die Freiheit nach Köln oder Amerika,… zu gehen. Zumindest für den Moment. Diese Überlegung, diese Widersprüchlichkeit, verstärkt mich nur in meiner Annahme, dass einen komplett freien Zustand, die eine große Freiheit nicht gibt. Ein paar einzelne Freiheiten, ja – aber komplett frei, nein.
Die Gedanken, die ich eben ausgeführt habe, hielten sich jedoch nur an Fakten und waren somit objektiv gehalten. Wir Menschen sind aber nicht objektiv. Wir haben Gefühle und sehen auf Sachen daher subjektiv. Ja, oben habe ich auch schon geschrieben, dass unsere Wirklichkeit subjektiv ist. Durch unsere limitierten Auffassungen der objektiven Wirklichkeit verschieben wir diese und erschaffen uns somit eine subjektive Wirklichkeit. Wie wir die Wirklichkeit sehen, auch wenn sie nicht wirklich so ist. Wenn wir eine subjektive Wirklichkeit haben, warum dann nicht auch eine subjektive Freiheit? Also was, wenn wir das Thema Freiheit jetzt subjektiv betrachten? Subjektiv geht es nicht darum, wie frei wir realistisch gesehen sind, sondern wie frei wir uns fühlen. Denn das macht uns als Menschen aus, dass wir starke Emotionen haben und diese auch eine sehr große, meiner Meinung nach sogar die größte Rolle in unserem Leben spielen. Jeder kennt doch den Ausdruck `hör auf dein Herz`. Und auf das Herz zu hören ist eindeutig subjektiv und nicht objektiv. Eine gute Metapher für Subjektivität und Objektivität ist meiner Meinung nach der Placebo-Effekt: objektiv kann das Mittel gar nicht wirken, aber das tut es dann trotzdem, weil wir Menschen subjektiv daran glauben. Weil etwas objektiv nicht möglich ist, muss es also subjektiv nicht auch unmöglich sein. Wenn man objektiv nie komplett frei sein kann, na gut – aber vielleicht ja subjektiv? Ich hoffe, jetzt ist verständlich geworden, warum ich die Freiheit unbedingt auch subjektiv betrachten will.
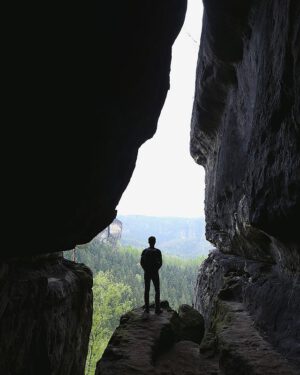 Ist Freiheit letztlich nur ein subjektives Gefühl?
Ist Freiheit letztlich nur ein subjektives Gefühl?
Wir sind es nicht anders gewöhnt, als objektiv nie komplett frei zu sein und damit kommen wir daher auch eigentlich gut klar. Wenn wir manche Sachen nicht machen wollen, die wir nicht machen können und über diese Sachen nicht nachdenken, fühlen wir uns auch frei. Beispielsweise kann ich im Moment nicht auf den Mars reisen, aber ich möchte es auch gar nicht, denke nicht darüber nach und fühle mich so auch nicht in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt. Was ich damit meine, ist, dass wir uns auch frei fühlen können, wenn wir es objektiv gesehen gar nicht sind. Ich glaube, dass man subjektiv also irgendwann komplett frei sein kann. (Obwohl das natürlich nicht immer klappt: wenn man unbedingt etwas will, das aber nicht tun kann, fühlt man sich natürlich auch nicht frei. Es hat auch viel damit zu tun, was man überhaupt will.)
Kein Mensch auf dieser Welt ist objektiv gesehen komplett frei. Manche haben jedoch mehr Freiheiten als andere, ich kann beispielsweise meine Meinung meistens sagen, was in Nordkorea nicht ganz so der Fall ist. Ich kann mich freier bewegen als Menschen mit körperlichen Behinderungen. Manche Menschen, beispielsweise sehr reiche, können sich zum Beispiel die Freiheit nehmen, die Tempo-Limits nicht zu beachten, während die meisten von uns sich daran halten müssen, aus Angst oder Respekt vor der Geldstrafe, welche für reiche Menschen einfach nicht so bedeutend ist. Also gibt es objektiv eindeutig Unterschiede darin, wie frei die Menschen sind, obwohl niemand komplett frei sein kann.
Subjektiv ist das jedoch anders. Letztendlich sind wir sehr emotionale Lebewesen und daher zählt oft eher, wie sich etwas anfühlt, anstatt wie es faktisch ist. Hier können auch ärmere Menschen freier sein als reiche, wenn sie mit ihrem Leben zufrieden sind und nichts wollen, was sie nicht haben können. Wenn sie nicht an die kalte Gier gefesselt sind und immer mehr, mehr und mehr haben müssen, wenn es dieses mehr manchmal nicht gibt. Oder sehr selbstreflektierte Menschen sind frei von der Frage, wer sie wirklich sind. Ihre Gedanken müssen nicht mehr so angespannt um dieses Thema kreisen und sie können sich entspannter zurücklehnen und über andere Sachen nachdenken, ohne dass ihnen irgendwelche quälenden Gedanken (über wer sie sind) im Hinterkopf herumgeistern und ablenken, sie in Beschlag nehmen. Sie sind dann frei von solchen Gedanken und den Gefühlen der Angst und Unsicherheit, die mit ihnen kommen. Sie konnten mithilfe von Selbstreflektion und dann Selbsterkennung einen grausamen Käfig in ihrem Kopf in ein goldenes Zuhause verwandeln. Dadurch sieht man, dass ich glaube, dass man daran arbeiten kann, zumindest subjektiv etwas freier zu sein. Sei es nun durch Selbstreflektion, einer ärztlichen Behandlung gegen eine Krankheit oder zu versuchen, sich mehr auf das Positive zu konzentrieren, um sich nicht mehr so sehr vom Negativen beeinflussen zu lassen.
 Ein Selbstreflexionskreislauf kann uns freier machen!
Ein Selbstreflexionskreislauf kann uns freier machen!
Aber warum stelle ich mir diese ganzen Fragen überhaupt, wenn ich doch stattdessen im Bett liegen und Netflix gucken könnte? Warum ist uns Freiheit so unfassbar wichtig, dass wir für sie, wie man an der jetzigen Situation erkennen kann, teilweise sogar die Gesundheit aufs Spiel setzen? Nun ja, auf die Handlungsfreiheit bezogen ist es für uns so wichtig, nicht tun zu müssen, was wir nicht tun wollen, da es ja immer einen Grund gibt, etwas nicht tun zu wollen. Weil diese Sache einem Schmerzen bereitet oder unglücklich macht. Und andersherum tun zu können, was man will, bringt einem Freude und macht einen glücklich. Deshalb ist die Handlungsfreiheit, im Moment gerade insbesondere die Bewegungsfreiheit, so wichtig für uns. Wir alle wollen glücklich sein, für manche ist dies wahrscheinlich sogar das Lebensziel und nicht frei zu sein, nicht frei handeln zu können oder im eigenen Kopf gefangen zu sein, bedroht unser Glück. Freiheit wird demnach also immer eine sehr große Rolle in unseren Leben spielen.
Jetzt ist es dunkel und ich sehe keine Vögel mehr. Doch ich lächle und meine Kopfschmerzen sind auch weg.
Quellen: Biologie-Hefter, Philosophie-Hefter
3. Preis
Charlotte Heidelbach:
Jedes Individuum dieser Erde hat eine gedankliche Freiheit
Die Freiheit spielt im menschlichen Leben eine bedeutende Rolle. Selbst im Alltag ist der Begriff in den unterschiedlichsten Situationen immer wieder zu finden. Aber was ist die Freiheit eigentlich und wie frei sind wir wirklich?
Als Freiheit wird grundlegend die Möglichkeit beschreiben, Entscheidungen zu treffen und dabei ohne Zwang zwischen verschiedenen Optionen auswählen zu können. Dabei sollte eine Entscheidung oder Wahl nicht von äußeren Einflüssen bestimmt werden.
„Wir“ bezeichnen vorerst eine Gruppe von Personen. Im Hinblick auf die Frage der Freiheit lässt sich das „wir“ auf unsere gesellschaftlichen Strukturen und damit grundlegend auf alle Menschen, spezifisch auf bestimmte Personengruppen beziehen. Da sowohl der Begriff der Freiheit, als auch der Begriff „wir“ flexibel und unterschiedlich auslegbar ist, verändert sich die spezifische Bedeutung je nach Variation. Wird folglich von Freiheit im Hinblick auf Frauenrechte wie das Recht auf Abtreibung gesprochen, impliziert das „wir“ vorerst eine weibliche Personengruppe. Wobei männliche oder diverse Personen davon nicht ausgeschlossen sind, sondern einfach nicht im Fokus stehen.
Der letzte, zu klärende Begriff im Hinblick auf die Leitfrage wäre die Wirklichkeit. Mit der Wirklichkeit wird der Zustand bezeichnet, der erlebt und wahrgenommen wird. Dieser befindet sich im Bereich der wahrnehmbaren Gegebenheiten oder Erscheinungen. Da die Wirklichkeit sehr unterschiedlich war genommen und aufgefasst werden kann, handelt es sich bei diesem Begriff wahrscheinlich um den vielseitigsten in der Fragestellung. Denn sowohl die Wahrnehmung als auch das Empfinden variiert nicht nur von Lebewesen zu Lebewesen, sondern sogar von Individuum zu Individuum.
Doch wie realistisch ist das wirklich? Treffen Sie ausschließlich Entscheidungen, die Ihre eigenen Ansichten vertreten und nicht von anderen Meinungen oder Ansichten beeinflusst wurden? Theoretisch sind wir dazu in der Lage Entscheidungen zu treffen, die ohne Einflüsse oder Prägungen entstehen. Tendenziell überdenken wir unsere Entscheidungen allerdings und lassen in diesem Prozess auch äußere Einflüsse wirken. Der Gedanke, welcher vorerst in unseren Köpfen entsteht ist vorerst frei. Wir dürfen und können denken was, wann und wieviel wir wollen. Auch wenn unsere Fantasie und Gedankenvielfalt nicht unendlich ist, werden wir im Hinblick auf unsere Gedanken nicht durch eine höhere Instanz eingeschränkt. Jedes Individuum dieser Erde hat folglich eine gedankliche Freiheit. Bei der Umsetzung der Gedanken ist die Freiheit allerdings nicht garantiert, denn die Durchführung und das Handeln ist durch allgemeine oder moralische Gesetze eingeschränkt. Zwar können die meisten Entscheidungen durchgeführt werden, ohne dass sie eingeschränkt sind, allerdings folgt unser Verstand schon den vorgegebenen Regeln und Gesetzten. Gerade in dieser Hinsicht werden wir stark sozialisiert, denn schon jedes Kleinkind weiß, dass Diebe, Mörder und Betrüger „schlecht“ sind und „falsch“ handeln. Ohne dieser Aussage eine Wertung zu geben, sind wir meiner Meinung nach sowohl durch moralische Gesetze, als auch durch allgemeine Gesetze wie das Grundgesetzt oder ähnliches in unserer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.
Jedoch ist es oft schwer zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Im Hinblick auf die aktuelle Pandemie werden uns viele Entscheidungen wie der Schulbesuch, das Shoppingwochenende oder ein Besuch im Restaurant vorentnommen um die Verbreitung des Virus zu bekämpfen. Viele Leute halten sich allerdings nicht an die Regeln, was nicht nur ihre Geldbörsen leerer macht, sondern teilweise sogar die Gesellschaft spaltet. Während viele Menschen auf den Verstand und die Vernunft ihrer Mitbürger hofft, gehen viele dieser weiterhin Feiern oder fliegen in den Urlaub. Auch wenn juristische Gesetze solche Entscheidungen nicht einschränken, stellt sich die Frage der Moral. Ist es richtig in den Urlaub zu fliegen, während Millionen von Menschen auf ihren Alltag und bestimmte Privilegien verzichten? Eine Frage die jeder für sich selbst entscheiden kann, solang er noch nicht Corona-positiv ist und in Quarantäne steckt.
Doch auch bei solchen Entscheidungen sind wir eingeschränkt. Sei es durch die Meinungen anderer oder die Gesetze des Landes. Diese Einschränkungen sind bei fast jeder Entscheidung gegeben. Allgemeine oder moralische Gesetze schränken Entscheidungen und damit unsere Freiheit ein. Ob dies nun etwas Gutes oder Schlechtes ist, wird Ihnen überlassen.
 Justitia und ihre Gesetze schränken unsere Freiheiten erheblich ein. Ist das nicht auch gut so?
Justitia und ihre Gesetze schränken unsere Freiheiten erheblich ein. Ist das nicht auch gut so?
Doch auf welchen Grundlagen treffen Sie ihre Entscheidungen? Die meisten Menschen sind wahrscheinlich davon überzeugt, dass sie ihre Entscheidungen aus freiem Willen treffen. Um von eigenen Entscheidungen sprechen zu können muss auch das Nichthandeln eine Option sein, die Folgen der Handlungen sollten zumindest grob absehbar sein können und es muss aus freiem Willen gehandelt werden um von einer „eigenen“ Entscheidung zu sprechen. Wir sind in der Freiheit unserer Entscheidungen einerseits von äußeren Faktoren wie Regeln, Gesetze und Normen eingeschränkt. Diese Einschränkungen werden auf neuronaler Ebene noch erweitert, denn die Erkenntnisse der neuronalen Forschung schränken die Möglichkeit auf Freiheit im Hinblick auf Entscheidungen immer weiter ein. So gut wie jeder neuronale Prozess lässt sich heutzutage einem bestimmten Hirnareal zuordnen. Alles was wir denken, tun oder fühlen ist ein Zusammenspiel neurophysiologischer Prozesse in unserem Hirn.
Um die „Freiheit“ unserer Gehirnprozesse ausfindig zu machen wurden im 20. Jahrhundert die Libet-Experimente durchgeführt. Das Ziel der Versuche war es, den Beginn der Hirnaktivität, als Folge auf einen Reiz, und den darauffolgenden Beginn der Muskelaktivität herauszufinden. Dabei sollte festgestellt werden ob die Probanden ihre Handlungsentscheidungen bewusst treffen. Dabei war der Zeitpunkt des Reizes und der darauffolgenden Handbewegung willkürlich und somit nicht voraussehbar.
Die Experimente zeigten, dass das motorische Zentrum des menschlichen Gehirns die Entscheidung, eine Bewegung auszuführen, bereits getroffen hat bevor den Probanden bewusst wurde, dass sie sich dafür entscheiden haben diese Bewegung auszuführen. Auch wenn der zeitliche Abstand sehr gering war, sprechen sich die Ergebnisse des Experiments gegen die Entscheidungsfreiheit des Menschen aus. Die Libet-Experimente stehen allerdings sowohl in neurowissenschaftlichen, als auch in philosophischen Kreisen unter starker Kritik.
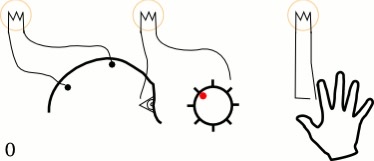
Was beweisen die Libet-Experimente über unsere Freiheit?
Demzufolge wäre der Mensch in seinen Entscheidungen nicht frei, da die Entscheidungen schon vor der bewussten Wahrnehmung getroffen wurden und sozusagen von unserem Körper getroffen wurden. Aus Sicht der Neurowissenschaft könnte es folglich sogar sein, dass die Freiheit nicht nur durch äußere Einflüsse eingeschränkt ist, sondern auch von körpereigenen chemischen Prozessen gesteuert wird, und damit nicht mal in unseren Gedanken vorhanden ist. Entscheidungen können wir treffen und Handlungen ausführen. Ob diese wirklich frei sind ist allerdings an der Auslegung bestimmter Faktoren zu bestimmen. Dass menschlichen Entscheidungen von äußeren Einflüssen geprägt werden ist relativ klar und nicht sonderlich streitwürdig. Aber sind wir auch in unserem Willen und Denken frei?
Sollten Entscheidungen tatsächlich nur von unserem Körper getroffen sein, setzt sie Einschränkung der Willensfreiheit eine klare Trennung von Körper und Geist vor. Sollten Entscheidungen von unserem Körper oder Gehirn getroffen werden und wir dadurch keine Entscheidungsfreiheit haben, wäre der Körper vom Geist getrennt und damit wäre es keine freie Entscheidung oder einen freien Willen. Wobei wir hier bei der Frage wären, was uns wirklich ausmacht und ob wir uns eher mit unserem Körper oder unserem Geist identifizieren.
Meiner Meinung nach stellen Körper und Geist ein sehr kompliziertes, verstricktes Zusammenspiel dar und sind nicht voneinander getrennt, weshalb ich von einer grundlegenden Willensfreiheit überzeugt bin. Auch wenn diese möglicherweise durch verschiedene Faktoren eingeschränkt sein könnte.
Folglich ist ziemlich klar, dass wir in unserer Entscheidungsfreiheit durch sehr viele Einflüsse eingeschränkt, und damit nicht komplett frei, allerdings auch nicht komplett begrenzt sind. Der viel schwierigere Punkt ist die Willensfreiheit, die weder klar nachgewiesen noch klar widerlegt werden kann. Meiner Meinung nach die eine gewisse Willensfreiheit gegeben, da Körper und Geist eine Kooperation darstellen, die sich nicht trennen lässt und dadurch eine Einheit darstellt, welche denken, fühlen und wollen kann.
Letztendlich sind wir alle so frei wie wir uns fühlen und vor allem wie wir die Freiheit auslegen. Bestimmte Einschränkungen sind ganz klar und offensichtlich, während andere vom persönlichen Empfinden abhängen und somit Auslegungssache sind. Schließlich ist nicht jeder gleich. Wir stellen die unterschiedlichsten Individuen dar, die unterschiedliche Empfindungen, Emotionen und Meinungen haben.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit (30.01.2021, 19:31)
https://www.dwds.de/wb/wir (30.01.2021, 19:41)
https://ethik-heute.org/sind-wir-in-unseren-entscheidungen-frei/ (7.02.2021, 10:38)
https://de.wikipedia.org/wiki/Libet-Experiment (7.02.2021, 10:50)
Sonderpreis
Lily Krusche :

Die Freiheit der Person gilt als unverletzlich
Wie frei sind wir wirklich? Diese Frage scheint auf den ersten Blick relativ einfach und man könnte der Ansicht sein, dass es recht leicht sei zu sagen „ja klar, wir sind doch alle frei“. Im Gegenzug wäre auch die Verneinung nicht einfach abzustreiten, denn die recht steile These „nein, wir sind nicht frei“ klingt gar nicht so abwegig.
Nun hier zeigt sich ohne Umschweife, dass die Frage scheinbar doch alles andere als einfach, nein, sogar sehr abstrakt und schwer zu beantworten ist. Denn wer sind eigentlich WIR und was soll schon WIRKLICH heißen. Vom Begriff FREI ganz zu schweigen. Wären wir nicht frei, wie frei sollten wir denn dann sein? Wollen wir überhaupt total frei sein? Können wir das überhaupt sein, schließlich sind wir ja am leben, schwingt bei jeder Freiheit nicht auch Einschränkung mit? Welche Zeit betrachten wir und über welche Rahmenbedingungen reden wir? Freiheit ist ein Begriff, den jeder subjektiv für sich definiert und lebt. Denn ein gemeinsamer Freiheitsbegriff, der universell für alle gilt, wäre schon wieder eine Konvention und Beschränkung, die den Freiheitsbegriff eines anderen aus sich heraus diktiert und somit unfrei ist.
Diese Gedanken gingen mir über die letzten Woche, als ich mit mit der o.g. Fragestellung auseinandergesetzt habe, durch den Kopf. Ich habe keine Antwort gefunden und komme mehr und mehr zu dem Schluss, dass es DIE Freiheit nicht gibt, sondern nur eine gemeinsamen Einigung als Gesellschaft darüber existiert, was Freiheiten für jeden bedeuten und wie hoch die Freiheit in einem Kollektiv zu werten ist. Gleichzeitig ist der Freiheitsbegriff somit dynamisch und im Kontext seiner Zeit zu bewerten.
Ich möchte in folgendem Text näher auf die Freiheit des Menschen als Individuum und Teil einer Gesellschaft eingehen, wobei ich das Leben in einer Demokratie genauer untersuchen und bewerten werde.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/als-berlin-1988-europaeische-kulturstadt-war-eingemauert1001.de.html?dram:article_id=410400
Mahnmal des ehemals durch eine Mauer geteilten Deutschlands
Absolute Freiheit würde nach der Definition vieler deutschsprachiger Lexika bedeuten, dass wir keine, für uns als Einschränkungen empfundenen, Zwänge mehr in unserem Handeln haben. Doch wie soll dies erreicht werden? Gesetze, sowie Werte und Normen mal außen vor, gibt es Grundbedürfnisse, die sich nicht umgehen lassen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man Nährstoffe zu sich nehmen und schlafen muss um zu überleben. Der Mensch als biologisches Wesen ist nicht in der Lage zu tun und lassen, was er will, wenn er dabei seinem Körper, also dem Grund, weshalb er am Leben ist, oder viel mehr dem Mittel, das ihn existieren lässt, schädigt. Es gibt biologische Triebe, denen wir nachkommen MÜSSEN, andernfalls sterben wir und auf die Frage, ob wir nicht im Tod absolute Freiheit erreicht haben, schließlich haben wir dann ja keinerlei Pflichten mehr, wage ich zu erwidern, dass wir dann nicht mehr existieren, was die Sache erschwert, da wir dann im Endeffekt sowieso keine Freiheit mehr leben können, also auch nicht frei sind.
Demnach können wir also nicht absolut frei von allem sein. Jedoch können wir auch abgesehen von biologischen Faktoren nicht alles machen, was wir wollen, denn bei absolut willkürlichem und freien Handeln würden wir andere in ihrer Freiheit beschränken. Kann man Teil der Gesellschaft sein, wenn man seine eigenen Freiheiten auslebt, dabei aber Regeln verletzt? Es gibt wichtige unerlässliche Freiheiten, die sowohl einem selbst uneingeschränktes Handeln, als auch den Schutz vor der Verletzung gewisser Freiheiten durch andere schützen. Wo hört also die eigene Freiheit auf und fängt die des anderen an?
Aus gehend von der Tatsache, dass wir nicht vollständig frei sind, da wir uns schließlich an innere Triebe, geltendes Recht, sowie anerkannte Werte und Normen halten müssen, stehe ich nun vor der Frage, ob der Mensch überhaupt frei sein möchte. Es wird aus eurozentrischer Sicht suggeriert, dass alles andere schlecht sei und Freiheit wird so gewissermaßen aufgezwungen, doch der Begriff Freiheit als Ideal kommt doch nur von der Tatsache, dass eben nicht jeder frei ist. Freiheit wird missbraucht und dies schafft Unterdrückung. Sie ist an Bedingungen geknüpft und kann nur bei Gleichheit funktionieren, wir sind aber nicht alle gleich. Das Einkommen bestimmt die Fülle der Freiheiten, Personen im Besitz von viel Geld sind, haben mehr Freiheiten, welche schnell ausgenutzt werden, wodurch gesellschaftliche Gruppen von Menschen unterdrückt und ausgebeutet werden.
Sind beispielsweise Asylsuchende frei? Nicht unbedingt, denn sie haben nicht die gleichen Rechte wie Menschen, die in einem demokratischen Staat leben. Und warum nicht? Weil Macht und Freiheit missbraucht werden. Somit werden ihre Rechte durch Diktatoren, die dadurch mehr Freiheiten haben, eingeschränkt. Durch diese Einschränkung anderer, verschaffen sich Personen in einer Machtposition größere Freiheiten, ohne Rücksicht auf die Freiheit der Unterdrückten. Aufgrund dieser Tatsache, nämlich, dass nicht alle die gleichen Rechte haben, da jeder einzelne eine andere Auffassung von Freiheit hat, jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat, die in der Gesellschaft unterschiedlich bewertet werden und jeder ein anderes Maß an Solidarität auslebt, leben wir demnach also in einer unfreien Gesellschaft (?).

https://www.br.de/telekolleg/faecher/sozialkunde/telekolleg-sozialkunde-1-102.html
Überreste der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor
Haben wir heute, als Staatsbürger eines demokratischen Staates, das Gefühl, in einer diesen zu leben? Ich denke, auf diese Frage würde jeder anders antworten. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl keine Freiheiten zu haben, schließlich steht im Grundgesetz laut Artikel 2, dass jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Zudem ist niedergeschrieben, dass die Freiheit des Glaubens, des Gewissens, sowie die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich sind und jeder das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern. Es ist mir gestattet, dorthin zu reisen, wohin ich will und mich wo immer ich möchte aufzuhalten. (vgl. GG Artikel 2 – 5). Demnach habe ich meiner Meinung nach als deutsche Staatsbürgerin sehr viele Freiheiten, die ich ausleben kann. Dies funktioniert in manche Bereichen mehr, in anderen weniger gut.
Die eben genannten Freiheiten gelten so, in einem Maß, in dem es noch sehr viel Platz für anderweitige Auslegung und Ermessensspielraum gibt, nur für Bürgen und Bürgerinnen des deutschen Staates. In anderen Demokratien ist es sehr ähnlich. Legt man das Augenmerk aber auf diktatorisch oder monarchisch geführte Staaten, sieht das Ganze schon etwas anders aus und man begegnet Unterdrückung sowie Ausbeutung in ausgeprägterem Maße in vielen Bereichen.
Selbst in Deutschland, einem demokratischen Staat, in dem die Freiheit der Person als unverletzlich gilt (vgl. GG Artikel 2), existiert Einschränkung von Freiheiten durch die Erweiterung der eigenen Freiheiten bestimmter Menschen mit Hilfe von Geld. So funktioniert unsere Staatsstruktur, nach dem Belohnungssystem, Menschen mit hohem Einkommen haben höhere Freiheiten.
Zur Aufarbeitung und Verbesserung dieses, fehlt es weder an Geld, noch an Mitteln, jedoch mangelt es an Initiative. Es wird nicht beabsichtigt dieses Defizit zu transformieren – nein, es wird sogar durch die Suggestion, bestimmte Lebensweisen seien nichts wert, da sie nicht dem Ideal entsprechen, beabsichtigt, dass arm und reich, sowie dumm und schlau noch weiter auseinander gehen, da unsere Gesellschaft in gewissem Maße auch nach dem konservativen Prinzip des Egoismus funktioniert. Ganz nach dem Motto: Was ich nicht hatte, kriegst du auch nicht. Jedoch ist die Transformation nicht aufhaltbar, wie man an dem Beispiel des freien Auslebens seiner Sexualität, was lange Zeit in Deutschland untersagt war und in vielen Staaten immer noch ist, erkennt.
Wenn man sich aber mal genauer mit Artikel 2 das Grundgesetz, der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung auseinandersetzt, fällt einem unschwer auf, dass in dieser Ordnung Freiheit vorgeschrieben ist. Moment, eine Ordnung schreibt Freiheit vor? Irgendwas passt da nicht. Wenn Freiheit vorgeschrieben wird, ist man in seiner Entscheidung und seinem Handeln nicht mehr frei, denn Freiheit ist ja schließlich Pflicht. Ist Freiheit jetzt also nichts weiter, als eine Illusion?
Nein ist es meiner Meinung nach nicht. So unfrei wie oben beschrieben ist es in Deutschland nicht, da das Leben in einer liberalen rechtsstaatlichen Demokratie, die individuelle Freiheit, auch was die Wahl der Lebensform sowie -weise angeht, möglich macht, meiner Meinung nach die zivilisierteste Form von Gesellschaft, die es jemals gegeben hat, ist. Denn sie ist veränderungsoffen und lebt in einer sich verändernder Umwelt davon, dass Vierbesserungsanregungen von Minderheiten, die Benachteiligung oder Entwicklungsdefizite beklagen, ausgehen. Soziale Bewegungen schieben Transformationsprozesse voran und durch notwendige Mechanismen wird verhindert, dass diese Veränderungen ausbleiben. Das „Prinzip einer demokratischen Politik“ sieht Philosoph Karl Popper in seinem Buch „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ darin bestehend, dass in einer Demokratie stabile Institutionen, wie zum Beispiel freie Wahlen und unabhängige Gerichte vorsehen, „die es den Beherrschten gestattet, die Herrscher abzusetzen“.
Somit, denke ich, sind wir, zumindest diejenigen von uns, die in einer Demokratie leben dürfen, frei. Denn wir haben die Möglichkeiten durch Prinzipien wie der Gewaltenteilung frei zu entscheiden, wie wir leben möchten. Wir sind zwar in bestimmten Handlungen nicht absolut frei, nämlich diesen, mit denen wir bei der Auslebung unserer Freiheit durch gewisse Handlungen gleichzeitig die Freiheit anderer einschränken, aber ich denke, das wollen wir auch nicht. Denn dann wäre kein Zusammenleben möglich. Ich denke, dass das Ziel eines glücklichen Lebens oder viel mehr für mich das Ziel meines glücklichen Lebens, ist es in einer Gemeinschaft zu leben, in der jeder ein gewisses, nämlich das gleiche Maß an Freiheit besitzt.
Freiheit als Grundwert ist ein Ideal, das niemals erreicht, aber immer verteidigt werden muss. Umgekehrt bedeutet es aber auch, sich immer zu überlegen wer sich für wessen Rechte und Freiheit mit welchen Mitteln einsetzt und wessen Freiheitsrechte dabei gleichzeitig eingeschränkt werden. Freiheitskampf bedeutet immer, das In-Frage-Stellen von Ordnungen. Hierbei begegnet sich der Freiheitskampf und der Terrorismus auf schmalem Grad. Wann spricht man von Freiheitskämpfern und wann von Terrorismus? Was für den Einen das Eine ist, bedeutet es für den Anderen das Andere. Sobald sich Menschen gegen totalitäre Ordnungen erheben, sind es für Bürger einer Demokratie als außenstehende Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte, doch für die Machthabenden der totalitären Staaten sind es Terrororganisationen, die Versuchen, das Regime zu stürzen.
Dafür gibt es in der Geschichte und auch aktuelle zahlreiche Beispiele, die zumeist nicht immer unblutig verliefen, wo letztlich dennoch Freiheit und Menschenrechte über Tyrannei und Unterdrückung siegten. Wie z.B. der Amerikanische Bürgerkrieg mit Abschaffung der Sklaverei, der Widerstand gegen Nazideutschland, die Überwindung des Apartheidregimes im Südafrika und vieles mehr. Dass jedoch auch gewaltsamer Widerstand zum Erfolg und zur Befreiung eines ganzen Landes frühen kann, zeigt die Befreiung Indiens von der britische Annektion.
Zum Abschluss lässt sich denke ich sagen, dass jeder Freiheit für sich selbst definiert. Für mich beispielsweise heißt Freiheit natürlich das Leben in einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat, aber das Gefühl von Freiheit bedeutet für mich nur eins:

https://www.cavallo.de/reitsportszene/das-grosse-sonderheft-der-pferdefotos/
Die Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung zum
10. HCG-Philo-Wettbewerb 2020/21
Wie frei sind wir wirklich?

Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So werden bevorzugt Themen gestellt, die entweder sehr aktuell sind oder im Interessenhorizont vieler Schülerinnen und Schüler liegen. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc. Das Thema wird jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.
Ausschreibungstermin ist jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtsferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturienten noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner/innen-Produkt erfolgt am 22. April, Kants Geburtstag. Urkunden und Preise werden dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer*innen.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 10. HCG-Philo-Wettbewerb 2020/21:
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Wie frei sind wir wirklich?“
Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion zu unserer Freiheit: Wer ist „wir“, was heißt „frei“ und wie sieht unsere „Wirklichkeit“ aus? Doch gibt es „die“ FREIHEIT im Singular überhaupt? Haben wir es nicht immer mit vielfältigen Handlungsmöglichkeiten und genauso auch Einschränkungen zu tun? Welche Freiheiten wollen, sollen oder können wir uns zum Beispiel in der gegenwärtigen Krise erlauben?
Wenn ihr das alles beantwortet habt, dann müsstet ihr fragen, wie wir, die Freiheit und die Wirklichkeit zusammenpassen. Vielleicht ist das für die eine oder den anderen von euch ja viel leichter zu beantworten, als ich studierter Fachphilosoph mir das vorstellen kann. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie ihr das Thema angeht: Metaphysisch, religionsphilosophisch, sprachphilosophisch, ethisch, anthropologisch, neuro-philophisch oder demokratietheoretisch. Wie beurteilst du das Ausmaß unserer tatsächlichen Freiheit? Du kannst „frei“ und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du das Thema in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, die zur Orientierung im Leben beitragen können. (Philosophieren heißt schließlich, sich in Grundfragen des Denkens, Lebens und Handelns zu orientieren.)
Dein Text soll maximal 4 Computer geschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangs-Stufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisch-begriffliches (nicht fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität.
Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays oder anderen Beitrags zur Frage „Wie frei sind wir wirklich“!
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
10. HCG-Philo-Wettbewerb 2020/21
Ausschreibung: Am 19.11.2020, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und alle 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays zur Frage „Wie frei sind wir wirklich?“.
Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, ca. 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Einsendeschluss: Am 12.02.2021 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/in: Am 22.04.2021 (Kants Geburtstag)
Preis: Ehrung, Bücher und Urkunden für die drei besten Texte
Herzlichen Glückwunsch!

22.04.2020 (Kants Geburtstag): Königsberg meldet Entscheidung im 9. HCG-Philo-Wettbewerb!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Jury der Philosophie-Lehrer*innen hat den 9. HCG-Philo-Wettbewerb entschieden! Unter den 74 eingesendeten Texten (bisheriger Rekord!) zum Thema „Sinn des Lebens“ wurden als beste ausgewählt die Essays von
Chiara Niedl (2. Semester) : 1. Preis
Sina Marasus (10. Jahrgang) : 2. Preis
Marie Borndörfer (2. Semester) : 3. Preis
Philos und seine Freunde, allen voran Herr Rußbült und die Philosophie-Lehrer*innen des HCG, gratulieren ganz herzlich!
Die Preisverleihung wird noch vor den Sommerferien stattfinden – wann genau und in welchem sozialen Rahmen, das ist gegenwärtig nicht absehbar.
Ich bedanke mich vielmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gehaltvollen und sehr anregenden Texte. Bis zur Ausschreibung des 10. HCG-Philo-Wettbewerbs am 19.11.2020, dem UNESCO-Welttag der Philosophie!
Dr. Ulrich Müller Berlin, den 22.04.2020
Hier lesen Sie die prämierten Essays:
1. Preis
Chiara Niedl:

Der biologische Sinn des Lebens reicht nicht mehr aus
Es ist eine Frage, die jeden von uns ein ganzes Leben lang begleitet. Den einen mehr, den anderen weniger, aber dennoch betrifft sie uns alle. Die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und genau mit dieser Frage möchte ich mich in diesem Essay beschäftigen. Grundsätzlich hat jeder eine andere Meinung zu diesem Thema, deshalb müssen zuerst ein paar Eckpunkte festgelegt werden, mit denen man sich an diese Frage herantasten möchte, also die Bedingungen oder besser gesagt die Basis festlegen, auf die man sich stützt.

Einfach mal ins natürliche Licht eintauchen und nachdenken!
Ich möchte hierbei betonen, dass die von mir getroffenen Aussagen und Feststellungen subjektiver Ansicht sind und nicht mit der Meinung anderer Personen übereinstimmen müssen, selbst wenn Eckpunkte festgelegt werden. Was für mich also zum Beispiel als logische Schlussfolgerung gilt, mag für den anderen überhaupt nicht logisch zu verstehen zu sein. Aber nun zu meiner „Interpretationsbasis“:
Allein die Frage „Was ist der Sinn des Lebens?“ ist schon mehrdeutig interpretierbar. Als erstes muss also festgelegt werden, wie die Frage für dieses Essay ausgelegt wird, genauer gesagt, mit welcher Interpretation man sich beschäftigen möchte. Das Wort „Sinn“ ist hier gleichzusetzen mit dem Wort „Zweck“, was so viel bedeutet wie „Warum leben wir?“. Es geht also darum, ob unser Leben einem tieferen Sinn unterliegt, also eine Sinnhaftigkeit hat. Der etwas mehrdeutigere Teil der Frage ist das verwendete Wort „Leben“. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dieses Wort zu deuten. Man könnte es beispielsweise auf das eigene Leben beziehen, dann würde die Frage so viel bedeuten wie: „Warum lebe ich/Welchen Zweck hat mein Leben?“. Eine andere Interpretations-Möglichkeit ist, das Wort „Leben“ auf das existieren der Menschheit zu beziehen oder als dritte Idee, damit gleich alles Leben zu meinen.
Es gibt also allein durch die Formulierung der Frage schon drei verschiedene Ansatzpunkte, um diese Frage zu beantworten oder es zu versuchen. Als weiteren wichtigen Aspekt würde ich gerne hinzufügen, dass auch die gesellschaftlichen Normen und Ansichten eine wesentliche Rolle bei der Auslegung beziehungsweise bei dem Ansatz spielen. Der Sinn des eigenen Lebens oder des Lebens überhaupt unterliegt also nicht nur einer subjektiven Ansicht, sondern auch einer allgemeingültigen Einstellung der jeweiligen Gesellschaft. Jede Gesellschaft hat doch eine recht klare Meinung darüber, was als sinnvoll anzusehen ist und was nicht, wobei sie sich meist nur auf das eigene Leben bezieht und weniger auf das Existieren der Menschheit oder des Lebens im Allgemeinen.
Ebenfalls erwähnenswert ist, dass nicht nur der Lebenszweck zu dieser Frage gehört, sondern meiner Meinung nach auch das Lebensziel. Vielleicht gibt es ja so etwas wie einen „generellen Lebenszweck“, dennoch ist das Lebensziel etwas ganz Persönliches. So kann es für den einen ein erfolgreiches Leben mit viel Geld sein, während ein anderer es für wichtiger erachtet, für andere da zu sein und Hilfsbedürftigen zur Seite zu stehen. Grundsätzlich sind das Lebensziel und der Lebenssinn zwar zwei Paar Schuhe, gehören aber dennoch eng zusammen, da sie sich nur schwer widersprechen können.
Ein Beispiel: Angenommen es ist unser Lebenszweck möglichst lange zu überleben, aber eine Person X hat es sich zu seinem Lebensziel gemacht zu sterben, würde sich das offensichtlich widersprechen. Wenn das nun bei Vielen so wäre, wären wir Menschen in diesem Beispiel ganz schnell ausgestorben, daher glaube ich, dass sich der Lebenssinn – sofern es einen gibt – und das Lebensziel zumindest nicht vollkommen widersprechen können, da das logisch einfach nicht sinnvoll wäre und den Prinzipien der Natur widersprechen würde.
Also ist das Lebensziel auch ein wichtiger Teil. Man könnte nun noch weitere Begriffe aufführen, die aus meiner Sicht ebenfalls zu der „Oberfrage“ dazu gehören, wie zum Beispiel die Lebenseinstellung, das würde nun aber zu weit führen und ist nicht elementar für die Beantwortung der Frage.
Dennoch gibt es noch einen weiteren sehr wichtigen Gedanken, den ich hier ausführen möchte, da dieser die Frage aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Wenn wir uns schon die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, sollten wir uns zuerst einmal darüber Gedanken machen, ob das Leben überhaupt einen „Zweck/Sinn“ nach unseren Vorstellungen hat. Ansonsten müsste die Frage nämlich nicht „Was ist der Sinn des Lebens“ lauten, sondern: „Gibt es einen Sinn des Lebens und wenn ja, was ist er?“ Ich finde, dass man auch diese Ansicht der Frage nicht vernachlässigen sollte. Es wäre ja auch denkbar, dass das Leben, auf welches man sich auch beziehen möchte, keinem höherem Zweck dient oder einen tiefer gehenden Sinn hat. Zumindest nicht nach unseren Maßstäben. Gehen wir, um es etwas zu vereinfachen, hier aber davon aus, dass das Leben einen Sinn hat und wir uns nun der Frage nach jenem stellen können.
Nachdem die Basis, auf der ich die Frage nun versuchen möchte zu beantworten, feststeht, ist es sinnvoll sich erst einmal der Interpretation zu widmen: „Warum lebe ich?“
Der Mensch sucht sich immer in irgendeiner Form einen Grund, wieso er etwas tut. Das bedeutet, dass wir uns als Menschen etwas suchen, was wir als wichtiger und größer als uns selbst ansehen und uns daher danach ausrichten können. Was bedeutet das also in Bezug auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Religion. Das ist die erste Ansicht, der ich mich widmen möchte.
Viele Menschen haben einen bestimmten Glauben. Dieser Glauben gibt ihrem Leben einen Grund, also einen Sinn und eine Ordnung. Für viele Gläubige ist daher ihre Religion – und für sie zu Leben – das, was ihren Lebenssinn ausmacht oder anders ausgedrückt, der Grund für sie zu Leben.
Andere Menschen haben sich beispielsweise der Wissenschaft verschrieben und widmen ihr all ihr Können sowie ihre Kraft und Zeit. Ihr Lebenssinn besteht also darin zu forschen und die Menschheit so voranzubringen, ihr also zu dienen (Regelfall, gilt nicht für alle). Das kann unterschiedliche Auslöser haben, wie als Beispiel ein prägendes Erlebnis in ihrem bisherigen Leben, was mich direkt zu einigen Vermutungen führt.
Meistens fällt eine solche Erkenntnis nicht einfach vom Himmel, sondern sie entsteht mit der Zeit oder durch ein plötzliches Erlebnis. Es ist also für unsere Ansicht unseres Lebenszweckes elementar, was uns geprägt hat.
Meiner Meinung nach spielt auch die Erziehung hierbei eine tragende Rolle. Ist man beispielsweise in einer nicht religiösen Familie aufgewachsen, sondern in einer sehr wissenschaftlich ambitionierten, so ist es wahrscheinlicher, dass man auch durch jene geprägt wird. Ich spreche hier von der Mehrheit und nicht von allen, natürlich gibt es immer auch „Ausnahmen“.
Ein weiterer Aspekt, der unsere Ansichten beeinflusst ist die Gesellschaft, wie ich am Anfang bereits kurz erwähnte. Grundsätzlich werden alle von der Gesellschaft beeinflusst, wie stark und ob positiv oder negativ, hängt von der jeweiligen Person ab. Dennoch ist es schwer, sich diesem Einfluss zu entziehen. Hat einer also die Ansicht, dass sein Lebenszweck darin bestünde, einfach nichts zu tun, so würde die Mehrheit das als nicht sinnvoll ansehen und dieser Person einreden, dass sie Unrecht hat.
Zusammengefasst ergibt sich daraus meine erste Schlussfolgerung:
Unsere persönliche Auffassung, warum wir leben, hängt sehr stark davon ab, was uns wie geprägt hat. Man sucht sich seinen Lebenssinn also nicht völlig frei aus. Die Ansicht, was das Leben lebenswert macht, wird also nicht rein subjektiv getroffen, sondern von vielen Faktoren beeinflusst.
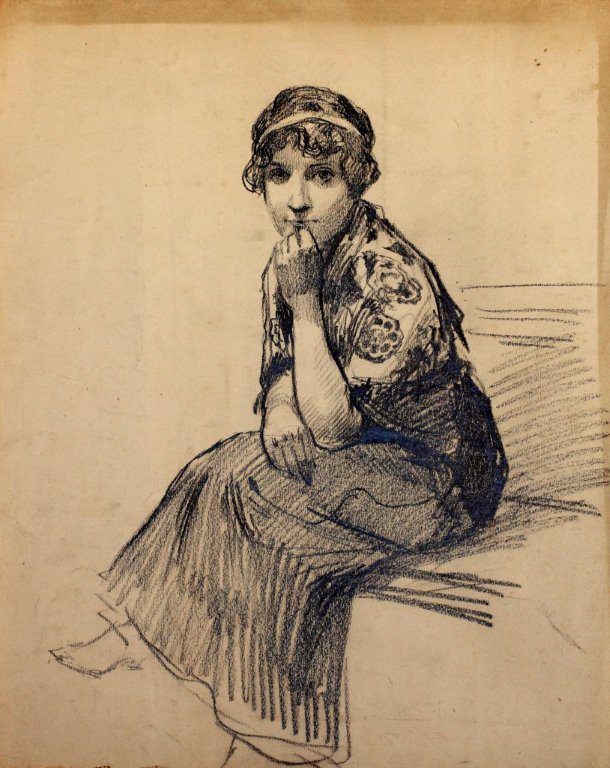
Nachdenkende
Ich widme mich nun der Frage ob es einen generellen Lebenssinn gibt. Da meine erste Schlussfolgerung ist, dass jeder eine individuelle Auffassung davon hat, was der Sinn des Lebens ist, kann es also in dieser Hinsicht keine allgemein gültige Meinung darüber geben. Daher muss man diese Frage aus einer anderen Perspektive betrachten. In diesem Fall die Biologie. Biologisch gesehen hat nicht jedes Leben einen individuellen Sinn, sondern hier muss nun die Menschheit als Ganzen betrachtet werden, also als „Art“. Welche Funktion hat die Menschheit denn nun, beziehungsweise ein Mensch allgemein? Meiner Meinung nach, genau den gleichen Zweck wie bei Tieren auch. Die Fortpflanzung und somit der Fortbestand der Art. Abgehen davon natürlich in erster Linie das Überleben, welches bei Menschen aber in anderer Relation steht als bei Tieren. Man könnte jetzt sagen, dass das unser Lebenszweck ist und die Frage damit beantwortet ist. Dann stellt sich aber wiederum die neue Frage, warum wir uns evolutionstechnisch so anders entwickelt haben. Außerdem gibt es einige Menschen, die sich nicht fortpflanzen wollen, sprich keine Kinder möchten. Das würde dieser Theorie ja widersprechen.
Daher komme ich zu meiner zweiten Schlussfolgerung:
Der ursprüngliche biologische Sinn eines Lebens, also das Überleben, wurde durch die menschliche Entwicklung quasi sinnlos. Auch die „natürliche Aussortierung“ der Schwächeren wurde durch die fortgeschrittenere Medizin und Technik weitgehend entkräftet. Dennoch denke ich, dass der Wille sich Fortzupflanzen immer noch gegeben ist, wenn auch nicht so wie bei Tieren. Wäre dem nicht so, wäre die Menschheit wahrscheinlich längst ausgestorbenen. Allgemein bin ich aber der Meinung, dass der biologische Sinn des Lebens (ob nun eines Individuums oder das einer ganzen Art, auf den Menschen bezogen) nicht mehr als alleinige Antwort auf diese Frage „gültig“ ist. Sie reicht schlichtweg nicht mehr. Dazu sei aber gesagt, dass das nicht heißt, dass sie falsch ist. Es benötige nun einfach noch eine weiterreichende Antwort, die alle Fragen beantworten kann. Ob es sie denn gibt, ist eine andere Frage.
Ob die Menschheit selbst einen Sinn hat – also ihr existieren überhaupt – lässt sich gleichsetzen mit der Frage, ob das Leben an sich einen Sinn hat. Dies ist auch die letzte Frage, auf die ich hier eingehen möchte.
Hat das Existieren von Leben einen Sinn? Ehrlich gesagt habe ich darauf keine passende Antwort gefunden. Bisher konnte man sich bei den erläuterten Fragestellungen immer an etwas orientieren, genauer gesagt, sich Anhaltspunkte suchen. Bei dieser Auslegung jedoch, geht es um die Frage nach der Existenzgrundlage. Ich persönlich sehe keinen speziellen Nutzen darin, dass es Leben gibt. Die einzigen die von unserem Leben profitieren, sind schlussendlich doch nur wir selbst. Daher kann ich auf diese Frage auch keine Antwort geben. Ich bin der Überzeugung, dass sich dazu jeder eine eigene Meinung bilden muss, denn sein wir mal ehrlich, wen interessiert es in 3000 Jahren, falls die Erde dann noch existieren sollte, ob eine Person mit Namen Chiara Niedl irgendwann mal gelebt hat, sofern sie keine revolutionären wichtigen Dinge entdeckt oder erfunden hat, die zu diesem späteren Zeitpunkt immer noch aktuell sind, genau niemanden. Und selbst wenn sie so etwas Tolles entdeckt oder erfunden hätte, wären es ja auch nur Nachfahren ihrer Art, die das für wichtig erachten würden.
Zusammengefasst kann ich also feststellen, dass die Frage, was der persönlicher Lebenszweck ist, etwas ganz Individuelles ist und jeder eine andere Meinung dazu hat, je nachdem was ihn geprägt hat und ihm wichtig erscheint. Zu der Frage was denn mein persönlicher Lebenszweck ist, kann ich nur Aus biologischer Sicht besteht der Nutzen einer Art beziehungsweise ein Teil dieser nur im Fortbestand und Überleben. Bezieht man die Frage nach dem Sinn des Lebens, auf das Leben überhaupt, stellt man sich damit die Frage nach unserer Existenzgrundlage. Auch diese muss jeder schlussendlich für sich selbst beantworten, da man selbst ja auch die Person ist, die damit leben muss. Nicht umsonst beschäftigt uns diese Frage schon seit tausenden von Jahren und bisher gibt es noch keine passende Antwort.
Dieses Essay legt also im Prinzip nur meine Sicht der Dinge auf dieses Thema da und kann höchstens andere dazu inspirieren, sich selbst einmal Gedanken darüber zu machen. Beantworten kann, meiner ganz persönlichen Meinung nach, kein Text, Essay oder irgendeine eine andere Abhandlung diese Frage, außer du selbst.
2. Preis
Sina Marasus:

Für das Leben gibt es weder Spielplan noch Spielmeister

„Monopoly“ des Lebens – oder doch lieber „Mensch ärgere dich nicht“?
Was ist der Sinn des Lebens? Das ist die Frage, die ich mir hier stellen muss. “Das Leben hat keinen Sinn“ war immer meine Antwort auf diese doch ach zu tiefgründige Frage. Es gab Zeiten, da habe ich oft darüber nachgedacht. Der Sinn des Lebens. Wir kommen auf die Welt um zu lernen, danach sollen wir das gelernte Wissen in einem Job anwenden können und somit viel Geld verdienen. Nachdem wir über die Hälfte unseres Lebens mit Lernen und Arbeiten verbracht haben, kommen wir an dem Punkt an, wo wir nicht weiter machen können. Wir sind schon zu alt um zu arbeiten. Wir sind nicht mehr in der körperlichen und mentalen Verfassung so weiter zu machen. Aber gut, ich habe ja genug Geld. Mit Geld kann ich mir den Rest meines Lebens schön machen. Obwohl, wenn man so darüber nachdenkt, dann gibt es doch gar nichts mehr, was ich mir von dem Geld kaufen möchte. Ich bin nicht mehr der junge Hüpfer, der ich einst war. Ich brauche nicht mehr den teuren Urlaub, die schicken Klamotten, das neuste Handy. Also, wozu habe ich mich jetzt mein ganzes Leben lang abgerackert? Am Ende werde ich eh in ein Heim gesteckt, weil ich keinen habe, der sich um mich kümmert. Später dann kann ich mich voller Schmerzen kaum noch bewegen und Gottes Endes werde ich dann auch schon bald im Sarg liegen. Also was ist das? Ist das der Sinn des Lebens? Zu arbeiten und dann einfach zu verschwinden? Will man wirklich einfach so leben, wie es einem vorgelegt wird? Ich jedenfalls nicht, aber was kann ich schon daran ändern?
Von klein auf wird einem doch schon die Frage gestellt “was möchtest du einmal werden?“. Und jeder erwartet doch auch eine ernste Antwort wie Feuerwehrmann, Architekt oder Ärztin. Die Leute würden es ja sogar noch akzeptieren, wenn eine 5-jährige sagt, sie wolle Prinzessin werden. Aber stellt euch doch mal vor, wenn jemand auf die Frage mit “glücklich“ antwortet. Da denken alle immer gleich “oh Mann, was für eine depressive, macht mal wieder voll das Drama“. Oder nicht? Also wenn ich so eine Antwort gegeben habe, wurde ich nur schief angeguckt, aber vielleicht sind das auch nur meine persönlichen Erfahrungen.
“Was möchtest du einmal werden?“
Was für eine dumme Frage. Ich kann mich nicht mal entscheiden, was ich essen oder anziehen soll. „Ich kriege doch schon bei dem Gedanken an die kleinsten Entscheidungen, die mein Leben nur irgendwie beeinflussen könnten, eine Panikattacke und fange an zu heulen“ -würden viele sagen. Ich treffe doch jeden Tag unzählige Entscheidungen bewusst oder unbewusst, wie soll ich dann bitte, eine so große Entscheidung für meine Zukunft treffen, die, wenn sie die falsche war, mein Leben “ruinieren“ könnte, um es hart zu sagen. Ich bin nicht Marty Mcfly aus “Zurück in die Zukunft“ und kann nicht mal eben in ein Auto steigen und mein Zukunft-Ich besuchen, um zu sehen wie ich in ein paar Jahren ticke. Ich verändere mich doch ständig. Jede Sekunde kann und wird etwas passieren, was meine Zukunft beeinflusst. Sei es, dass ich psychisch und körperlich wachse oder sei es auch nur, dass jemand etwas Bestimmtes getan oder zu mir gesagt hat. Die kleinsten Wörter und Gesten, die doch so unscheinbar wirken, können etwas in meinem Kopf auslösen, was meine Sicht, Gefühle und Gedanken um 180° dreht.
Das Leben hat keinen Sinn.
Dachte ich zumindest immer. Der Grund dafür?
Noch eine Sichtweise. Ich bin nicht wie ein Pferd mit Scheuklappen durch die Welt gelaufen. Immer nur eine Sicht und nie zur Seite schauen oder sich mal umdrehen. Ich bin mit einer Schlafmaske herumgelaufen. Keine Einschränkung des Sichtfeldes, sondern eine totale Abschottung. Wenn man mit so einer Art Maske rumläuft, hat man nicht mal eine Perspektive. Ich dachte, ich habe keine Zukunft. Jeder, der sagen konnte, wo er sich in 5 oder 10 Jahren sieht, lügt doch. Es sind doch nur Wunschvorstellungen, die man preisgibt. Wenn man sagt, in 10 Jahren da habe ich DAS studiert, wohne an DEM Ort und stehe in SO EINER Beziehung zu dieser Person, dann sind das doch in gewisser Weise Wünsche und Träume, die man hat. Besser gesagt, ist dieses Zukunft-Ich, von dem man erzählt, das Ich, von dem mein Jetzt-Ich denkt, dass es in der Zukunft sein wird.
Zu kompliziert?
Also, ich meine das so: Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt oder wenn ich vor 10 Jahren über mein jetziges 15-jähriges Ich nachgedacht habe, dann kann ich behaupten, dass sich meine Vorhersagen nicht wirklich bestätigt haben. Ich dachte immer, mit 15 bin ich so schlau und schön und noch vieles mehr. Wenn ich über die Zukunft nachgedacht habe, war ich immer so gespannt und neugierig. Ich konnte es kaum abwarten, bis dieser eine Zeitpunkt gekommen war.
In den letzten Jahren ist diese Neugier und Zuversicht abhandengekommen. Mir zu mindestens. Ich weiß, viele sagen das ist nur die Pubertät, die da aus einem kommt. Aber was, wenn nicht? Oder besser gesagt, ja, das kann gut möglich sein. Die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten, aber auch der schwierigsten. Es ist die Zeit zwischen Kind- und Erwachsenenleben. Es wird von einem erwartet, sich wie ein Erwachsener zu benehmen, wird aber selbst wie ein Kind behandelt. Es ist die Zeit, wo so viel in einem verrücktspielt und selbst der größte Freund in manch Augen als Feind angesehen wird. Es ist die Zeit, in der man in einem ständigen Konflikt mit sich selbst ist und die Leute von außen nur noch mehr Brennholz in das Feuer, das in einem lodert, werfen. In dieser Zeit passiert so viel und doch fühlt es sich an, als ob die Zeit steht und man nicht vorankommt. 7. Klasse,… 8. Klasse,… 9. Klasse,… 10. Klasse.
Wie lange noch ?
Noch 2 Jahre. Dann hab ich mein Abitur. Soll das ein Ansporn sein? Ich habe doch schon seit Jahren die Hoffnung an mich und eine vernünftige Bildung aufgegeben. Aber das ändert sich ja auch irgendwie nicht. Wie denn auch ? Es ist immer das gleiche. Ich sitze seit 10 Jahren im gleichen Loch und es vergrößert sich mit jedem Jahr. Es ist so, als würde die Dunkelheit und Einsamkeit einen verschlingen. Ich will nicht sagen, dass ich es doch ach so schwer und andere es leichter haben. Das würde ich nicht wagen. In Deutschland haben wir es gewiss nicht so schwer, wie Kinder in anderen Ländern. Mir ist all das ja auch durchaus bewusst. Nur.. heißt das nur, weil andere vielleicht größere Probleme haben, sind meine weniger wichtig? Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Probleme für Außenstehende lächerlich und nicht wie echte Probleme wirken. Ich meine, wir haben sie doch alle. Die Probleme. Und jeder weiß doch genau was und wie ich mich fühle.
„So fühlen wir uns doch alle mal.“
Ja, das stimmt. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Aber genau solche Aussagen, wie „das kenne ich“ sind Gründe, weshalb bestimmte Leute sich immer mehr abschotten. Was bringt es den Leuten zu sagen, wie es einem geht, wenn es uns doch allen so geht? Es kümmert doch keinen. „Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen“- sagt man doch so schön, und „…ich soll mich ja mal nicht so anstellen“. „Man will doch nur Aufmerksamkeit. So schlecht kann es einem doch gar nicht gehen“. Was habe ich schon groß rumzunörgeln? Ihr habt ja Recht. Aber wagt es dann ja nicht wieder vorzuheulen, ihr würdet „immer für dich da sein“. Denn, wow, dieses „immer“ ist häufig eine recht kurze Zeit, muss ich sagen. Aber vielleicht haben wir auch nur unterschiedliche Vorstellungen von der Bedeutung von „immer“.
Also was treibt uns in dieser Zeit des Lebens an?
Na ja, manche haben vielleicht schon eine der bereits erwähnten Wunschvorstellungen. Andere leben einfach weiter ohne groß darüber nachzudenken, wofür sie leben. Aber andere… ja andere hingegen haben diesen “Lebenssinn“ nicht. Sie sehen nicht ein, wozu sie sich noch körperlich aber vor allem auch psychisch fertig machen lassen sollen. Viele unterschätzen es, wenn Leute diese Art von Gedanken haben. Sie nehmen es nicht ernst oder denken, sie wüssten gut Bescheid und haben alles unter Kontrolle. Aber lasst mich eins hinterfragen. Wie könnt ihr sagen, Kontrolle zu haben, wenn ich schon längst die Kontrolle über mich selbst verloren habe? Oft führt diese Verharmlosung der Dinge zu einem Ende.
Suizid.
Ein Ereignis, welches ich als nachvollziehbar empfinde. Es ist nun mal nicht sehr unwahrscheinlich und verachtenswert, wenn jemand seinem Leben ein Ende setzen will. Wieso sagen Leute, es sei “selbstsüchtig“? Habe ich nicht das Recht zu entscheiden, was ich mit meinem Leben anfangen will? Sagen sie das, weil sie es als unfair empfinden, wenn ich mir mein Leben nehme und andere Menschen auf der Welt nur zu gerne so ein Leben wie ich führen wollen würden, da es immer noch besser ist, als das was sie haben? Um es hart zu sagen: Ich habe nie darum gebeten, geboren zu werden. Nein, habe ich nicht. Niemand hat das. Aber gibt es mir dann immer noch das Recht dazu mein Leben einfach “wegzuwerfen“?
Man wird geboren und einem sind die Grundrisse des Lebens vorgelegt.
Stellt euch das Leben wie ein Haus mit einem langen Flur vor. Es gibt verschiedene Türen und ihr könnt immer noch zwischen diesen wählen, aber der Grundriss bleibt derselbe. Nun ist es euch überlassen, wie ihr den Flur gestaltet. Am Ende des Flurs gibt es nichts mehr. Das Ende des Flurs ist das Ende des Lebens. Es ist eure Aufgabe, den Flur zum Ende dessen zu gestalten, damit ihr später auf den langen Flur hinab schauen könnt und glücklich mit der Wahl eurer Deko seid. Ok, vielleicht habt ihr ein paar Fehlentscheidungen getroffen und ein hässliches Bild aufgehängt oder Vorhänge genommen, die nicht zum Teppich passen, aber das sind die kleineren Übel und ohne diese Fehlkäufe könntet ihr es auch nie besser machen. Was ist aber, wenn ich die Wände nur schwarz streichen möchte, Vorhänge geschlossen halte und am Ende auf den immer gleich aussehenden Flur blicke? Es kann auch sein, dass ich nicht in dem Haus bleiben will und einfach aus dem Fenster springe. Hat sich mein Leben dann dennoch gelohnt? War das mein Sinn des Lebens? War mein Leben dennoch erfolgreich trotz schwarzer Wände? Oder eine bessere Frage:
Wer entscheidet ob mein Leben erfolgreich und sinnvoll war?
Das Leben hat keinen Sinn.
Du kommst nicht auf die Welt und hast einen Spielplan des Lebens bereit. Du weißt nicht, wo du überall hin musst und was du zu tun hast. Nun gut, es gibt natürlich immer Leute, die meinen, sie müssten dein Leben bestimmen oder wüssten, wie du deine “Spielfigur des Lebens“ zu schieben hast. Aber es tut mir leid, euch hier enttäuschen zu müssen. Es gibt keinen sogenannten Spielmeister und wenn es einen gibt, dann trage nur ich alleine das Recht diesen Titel zu tragen. Spiel nach deinen eigenen Regeln und baue dir dein Leben über das Spielbrett hinaus auf.
Das Leben hat keinen Sinn, aber ich gebe ihm einen.
Anmerkung: Die Ich-Erzählperspektive ist nicht durchgehend identisch mit der des Autorinnen-Ichs.
3. Preis
Marie Borndörfer: 
Auf der Suche nach dem Sinn entsteht der Sinn
Was ist für mich der Sinn des Lebens? Natürlich möchte ich zum Beispiel mein Abitur schaffen und eine Familie gründen. Doch das sind eigentlich nur Ziele, die ich gerne erreichen will, und für die es sich lohnt zu leben, aber sie sind doch nicht der Sinn meines Lebens, oder doch?
Ich bin der Meinung, dass es nicht „die eine Antwort“ auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gibt, denn ich denke, dass der Weg das Ziel ist. Aus der Suche nach dem Sinn des Lebens entsteht der Sinn. Um diese These zu diskutieren, habe ich über viele verschiedene Antworten nachgedacht. Meine Gedanken werde ich in diesem Essay erläutern.
Ich habe als erstes versucht mich der Frage zu nähern, in dem ich die Worte untersucht habe, aus denen sie besteht. Wenn man die beiden Worte im Duden nachschlägt, findet man 5 Bedeutungen für „Sinn“ und 4 für „Leben“. Diese Vielfalt bedeutet, dass man die Frage auf verschiedene Weisen verstehen kann. Beispiele dafür wären: Kann man das Leben bejahen oder muss man es verneinen? Hat das Leben einen Wert? Hat das Leben einen Zweck? Und gibt es generell EINEN Sinn des Lebens? Mir würden dazu noch sehr viele ähnliche Fragen einfallen, doch das Umformulieren führt nur dazu, dass die Frage immer unklarer wird. Eigentlich weicht man damit der Frage aus, dabei ist jedem durchaus klar, was gemeint ist. Warum interpretiert man die Frage dann um? Liegt es vielleicht daran, dass man Angst hat, dass die Antwort negativ wird? Fangen wir deshalb mit den Zweifeln an.
Es gibt das „Ich bin so klein“-Argument. Manchmal, wenn ich abends in den Sternenhimmel gucke, dann wird mir klar, wie klein ich doch eigentlich bin und wie klein auch die Erde ist. Sie ist nur ein ganz ganz kleiner Punkt in unserem Universum und ein noch kleinerer Punkt bin ich. Was auch immer wir auf der Erde tun hat eigentlich keine Auswirkungen auf das Universum und ist für das Universum bedeutungslos. Und deshalb ist auch unser Leben bedeutungslos. Dieses Argument kann man auch in der Zeit führen. Ich stelle mir dann immer die Frage, was eigentlich ist, wenn ich tot bin? Wer wird sich dann noch an mich erinnern? Ich weiß zum Beispiel schon nichts mehr von meiner Uroma und generell nur sehr wenig von meinen Vorfahren. Doch wenn sich niemand mehr an mich erinnert, wenn ich tot bin, war mein Leben dann sinnlos? So wie das meiner heute nicht erinnerten Vorfahren? Ich finde das nicht, denn ich glaube, dass der Sinn des Lebens nichts mit der Erinnerung an das Leben zu tun hat. Die Frage stellt sich, während ich lebe. Die Frage nach dem Sinn des Lebens betrifft außerdem jeden individuell, deswegen spielt auch die Größe des Universums keine Rolle.

Die Größe des Universums spielt für unseren Sinn keine Rolle
Ein weiteres negatives Argument ist das „Selbstmord-Argument“: Was ist, wenn sich eine Person umbringt – verneint sie dann den Sinn ihres Lebens? Das ist wohl so, doch das heißt meiner Meinung nach nicht, dass es generell den Sinn des Lebens nicht gibt. Die individuelle Verneinung stellt den generellen Sinn nicht in Frage.
Am schwierigsten finde ich das „Zufalls-Argument“. Es betrachtet die Menschen, denen schreckliche Dinge widerfahren oder die leiden. Das Leid und deshalb auch ihr Leben empfinden sie als sinnlos. Warum müssen diese Menschen leiden? Völlig sinnlos, oder man könnte auch sagen, rein zufällig? Ist das ganze Universum ein einziger großer Zufall? Sind Menschen einfach zufällig entstanden? Ich finde, diese Vorstellung sehr beängstigend. Genau diese Idee der sinnlosen Existenz mit sinnlosem Leiden steht hinter der Darstellung von Gregor Samsa in dem Buch „Die Verwandlung“ von Franz Kafka. Samsa wacht morgens auf und ist eine riesige Kakerlake. Aber diese absurde Situation weist auch auf einen Widerspruch hin. Ich frage mich nämlich, wieso wir den Zufall hinterfragen, wenn wir selbst aus dem Zufall entstanden sind. Ist es nicht merkwürdig, dass die Geschöpfe des Zufalls und des Sinnlosen einen Sinn suchen? Das erscheint mir unlogisch. Kommt mir zufällig der Gedanke nach der Frage nach dem Sinn des Lebens? Das ist mir ein Zufall zu viel.

Der verwandelte Gregor Samsa
Mit der Meinung bin ich nicht alleine und deshalb sind im Laufe der Zeit viele Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens gegeben worden.
Eine mögliche Antwort ist die Religion. Was das betrifft, erinnere ich mich an einen Besuch im jüdischen Museum. Weihnachten 2017 war ich mit meiner Familie in dem jüdischen Museum in Berlin, genauer gesagt in der Sonderausstellung „Jerusalem“. In dieser Ausstellung wurden unter anderem auch Echtzeit-Dokumentationen gezeigt, die den Alltag von vielen Juden in Jerusalem und Interviews mit ihnen zeigten. Bei der Frage, was den Bewohnern am Wichtigsten sei, haben sehr viele geantwortet: „Die göttlichen Gesetzte. Mein Sinn des Lebens ist es, sie zu befolgen.“ Ich fand es erstaunlich, dass es Menschen gibt, die für ihre Religion leben und das als Sinn ihres Lebens definieren. Doch je nachdem, zu welcher Religion man gehört, glaubt man ja an Verschiedenes. Könnte es sein, dass es je nach Religion einen unterschiedlichen Sinn gibt? Und wie ist es mit mir? Ich gehe zwar regelmäßig in die Kirche, würde das Christentum aber nicht als Sinn meines Lebens definieren.
Für die Atheisten kann Religion nicht der Sinn sein. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis gefragt und es gab viele, die auch im „Leben an sich“ einen Sinn sehen. Tatsächlich finde ich, dass Menschen oder Lebewesen (zum Beispiel die Tiere), die gar nicht nach dem Sinn fragen, ihn in gewisser Weise gefunden haben. Sie leben im Augenblick und erscheinen glücklich. Viele Menschen arbeiten daran, genau diesen Zustand durch Meditation zu erreichen. Dabei versuchen sie alles auszublenden, sich nur auf den eigenen Körper zu konzentrieren und den Körpermittelpunkt zu finden. So wollen sie eins mit dem Universum werden. Ist das der Sinn des Lebens, also eins mit dem Universum zu werden? Vielleicht, doch die meisten Menschen schaffen das nicht.
Eine Antwort, die ich überhaupt nicht überzeugend finde, ist, wenn man sein Leben für jemand anderen führt. Das kann nicht der Sinn sein, denn man wird dadurch nicht glücklich. Man muss mit sich selbst zufrieden sein und sich selbst lieben. Ein bekanntes Sprichwort lautet: Das Leben ist wie eine Münze, man kann sie ausgeben wie man will, aber nur einmal. Genau so wenig ist der Sinn des Lebens übertragbar. Der Sinn meines Lebens ist nicht, dass meine Eltern mich wollten.
Was ist mit Antworten wie „Gitarre spielen“? Sind das dumme Antworten? Ich finde nicht. Meiner Meinung nach sollte jeder das machen, was ihm Spaß macht. Solange man für sich selbst findet, dass z.B. Gitarre spielen der Sinn des eigenen Lebens ist, ist das völlig in Ordnung. Man sollte nur nicht der Meinung sein, dass das generell der Sinn für jeden sein sollte.
Was soll man aus diesen Antworten schließen? Ist eine richtig und die anderen falsch? Leben die Menschen, die an die falsche Antwort glauben, ein sinnloses Leben? Oder gibt es viele mögliche Antworten, die einen Sinn stiften können? Denn darauf kommt es doch an: dass man selber einen Sinn findet. Ich denke, dass es keinen eindeutigen Sinn des Lebens gibt, sondern dass sich jeder seinen eigenen Sinn suchen muss. Auf der Suche entstehen Ziele, die für den einzelnen einen individuellen Sinn ergeben können. Die Suche nach dem Sinn bringt das Beste in uns hervor. Sie stellt uns über unsere bloße biologische Existenz. Ich glaube, der Weg ist das Ziel – auf der Suche nach dem Sinn entsteht der Sinn. Das bedeutet natürlich auch, dass man sich anstrengen muss, um einen Sinn zu finden. In diesem Sinne – machen wir uns auf die Suche!
Quelle: Der Sinn des Lebens. Christoph Fehige, Georg Meggle, Ulla Wessels (Herausgeber). dtv Verlag, 2000.
Die Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung zum
9. HCG-Philo-Wettbewerb 2019/20
Sinn des Lebens
 Hieronymos Bosch: Engel begleiten die Seelen ins Jenseits
Hieronymos Bosch: Engel begleiten die Seelen ins Jenseits
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So werden bevorzugt Themen gestellt, die entweder sehr aktuell sind oder im Interessenhorizont vieler Schülerinnen und Schüler liegen. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc. Das Thema wird jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.
Ausschreibungstermin ist jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtsferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturienten noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner/innen-Produkt erfolgt am 22. April, Kants Geburtstag. Urkunden und Preise können dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht werden.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer*innen und den Förderverein.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 9. HCG-Philo-Wettbewerb 2019/20:
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Sinn des Lebens“
Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion zur Frage „Was ist Lebenssinn“? Welcher Philosoph und welcher Religionslehrer wäre wohl noch nicht von Freunden, Bekannten, Kolleg*innen oder Nachbar*innen nach dem Sinn des Lebens gefragt worden? Scheinen wir dafür doch Experten zu sein. Doch gibt es „den“ Sinn im Singular überhaupt? Haben wir es nicht immer mit vielfältigem Lebenssinn zu tun? Und was heißt hier eigentlich Sinn? Wie unterscheidet er sich von Bedeutung, Zweck, Ursache oder Ziel? Genauso müsste nach dem Inhalt des Begriffs Leben gefragt werden: Ist das Leben etwa die Summe meiner Erlebnisse oder einfach meine Bewegung durch Raum und Zeit?
Wenn ihr das alles beantwortet habt, dann müsstet ihr fragen, wie Sinn und Leben zu einander passen. Vielleicht ist das für die eine oder den anderen von euch ja viel leichter zu beantworten, als ich studierter Fachphilosoph mir das vorstellen kann. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie ihr das Thema angeht: Metaphysisch, religionsphilosophisch, sprachphilosophisch, ethisch, anthropologisch, neurophilosophisch oder gar ästhetisch?
Besonders spannend zu erfahren, wäre für mich: Was ist dein Konzept von Lebenssinn? Du kannst frei und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du das Thema in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, die zur Orientierung im Leben beitragen können. (Philosophieren heißt schließlich, sich in Grundfragen des Denkens, Lebens und Handelns zu orientieren.)
Dein Text soll maximal 4 computergeschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangsstufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisch-begriffliches (nicht fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität.
Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays oder anderen Beitrags zum Thema „Sinn des Lebens“!
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
9. HCG-Philo-Wettbewerb 2019/20
Ausschreibung: Am 21.11.2019, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und alle 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays zum Thema „Sinn des Lebens“.
Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe.
Einsendeschluss: Am 12.02.2020 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/in: Am 22.04.2020 (Kants Geburtstag)
Preis: Ehrung, Bücher und Urkunden für die drei besten Texte.
Herzlichen Glückwunsch!

22.04. 2019 (Kants Geburtstag): Königsberg meldet Entscheidung im 8. HCG-Philo-Wettbewerb!
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Jury der Philosophie-Lehrer hat den 8. HCG-Philo-Wettbewerb entschieden! Unter den 48 eingesendeten Texten zum Thema “Selbsterkenntnis“ wurden als beste ausgewählt die Essays von
Jolene Hoeth (4. Semester) : 1. Preis
Florian Wejda (2. Semester) : 2. Preis
Berrin Yetiskin (4. Semester) : 3. Preis
Philos und seine Freunde, allen voran Herr Rußbült und die Philosophie-Lehrer*innen des HCG, gratulieren ganz herzlich!
Die Preisverleihung wird im Rahmen der Abitur-Entlassungsfeier am Freitag, den 14. Juni (für Jolene und Berrin) und am Mittwoch, den 19. Juni (für Florian) erfolgen.
Ich bedanke mich vielmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gedankenreichen und anregenden Texte. Bis zur Ausschreibung des 9. HCG-Philo-Wettbewerbs am 21.11.2019, dem UNESCO-Welttag der Philosophie!
Dr. Ulrich Müller Berlin, den 22.04.2019
Jolene Hoeth: Selbsterkenntnis als Schlüssel für Zufriedenheit und eigenes Glück

In ihrem Essay begründet Jolene zunächst, warum Selbsterkenntnis, ein klassisches Thema, heute noch wichtig ist. Im Anschluss an den Philosophen Ralph Waldo Emerson werden dann Ehrlichkeit zu sich selbst sowie Mut zum eigenen Urteil als die wichtigsten Voraussetzungen einer erfolgreichen Selbsterkenntnis in Ansatz gebracht. Zum Schluss erläutert Jolene am Beispiel von Meditation und Traumdeutung, wie Selbsterkenntnis, das nach Kant schwierigste Geschäft vernünftiger Wesen, gelingen kann.
Es war im Juni letzten Jahres. Ich stand vor dem Eingangsportal des Orakels in Delphi. Seine Größe und Schönheit überwältigten mich. Ich spürte die Tiefgründigkeit und Harmonie dieser Kultstätte. ,,Gnothi seauton” stand früher am Eingangsportal, zu Deutsch: ,,Erkenne dich selbst”. Diese Worte brachten mich ins Grübeln. Was sollte das bedeuten? Sich selbst erkennen? Kennt man sich selbst nicht schon? Wie soll man sich erkennen? Etwa in einem Spiegel?
,,Erkenne dich selbst” war für mich eine Aufforderung, mich mit meiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Denn wenn diese Worte am Eingangsportal dieses Orakels stehen, müssen Menschen im fünften Jahrhundert vor Christus schon zu dem Schluss gekommen sein, dass Selbsterkenntnis grundlegend im Leben eines jeden ist. Die Frage ist nur, grundlegend wofür?
Es macht Sinn, dass man sich selbst erkennen soll, sich selbst sollte man schließlich am besten erkennen und kennen können. Denn wenn man sich selbst nicht kennt, kann man sich auch niemand anderem offenbaren und ihm erlauben, sich zu kennen. Und wenn man sich selbst nicht kennt, wie sollte man dann jemand anderen kennen können? Sich selbst erkennen und sich selbst kennen sind also essentiell, doch ist beides überhaupt gleichzusetzen oder muss hier differenziert werden? Sich selbst kennen bedeutet für mich, seine innersten Bedürfnisse, Ziele und Ängste zu kennen, zu wissen, wer man selbst ist und wie man selbst tickt. Selbsterkenntnis, also die Erkenntnis der eigenen Person und Persönlichkeit, erfordert, aus meiner Sicht, dass man sich selbst kennt und sich im Folgenden mit seiner eigenen Person auseinandersetzt. Das heißt, es wagen seine Bedürfnisse auszuleben, seine Ziele zu verfolgen und Ängste auszusprechen. Sich selbst kennen und sich selbst erkennen bedingt sich also gegenseitig. Andere kennen zu können scheint demnach paradox, können wir doch nicht ihre innersten Bedürfnisse, Ziele und Ängste kennen. Lediglich vermuten können wir sie und daher können wir auch nur vermuten andere Menschen zu kennen. Wir können wissen, wie wir sie wahrnehmen und auch was wir glauben zu denken, wer sie sind. Kennen aber können wir andere Personen, als die „eigenen“, aber nicht.
Wieso jedoch ist Selbsterkenntnis so wichtig und wie kann man sie erlangen?
Viele würden jetzt bestimmt antworten: ,,In einem Spiegel kann man sich selbst erkennen”. In einem Spiegel kann man sich durchaus wiedererkennen, er liefert ein visuelles Abbild deiner selbst. Selbsterkenntnis erlangt man durch einen Blick in den Spiegel jedoch noch nicht, denn diese ist tief in unserem Unterbewusstsein verborgen.
Der Wille, sich selbst kennen zu lernen und zu erkennen hat, auf dem Weg zur Selbsterkenntnis natürlich die oberste Priorität. Eine weitere wichtige Voraussetzung, um Selbsterkenntnis erhalten zu können, ist absolute Ehrlichkeit zu sich selbst. Ehrlichkeit spielt eine immense Rolle, da wir uns auf dem Weg zur Selbsterkenntnis von jeder Art der Selbsttäuschung befreien wollen und müssen. Aus dieser Befreiung resultiert, logischerweise, eine Änderung des Selbstbildes. Um ehrlich sein zu können, müssen wir also bereit sein, unser neues ,,Selbstbild” zu akzeptieren. Das kann für das einzelne Individuum schwer sein, wirft es doch alles, oder beinahe alles, über Bord, das wir geglaubt haben über uns selbst zu wissen. Möchte man wirklich Selbsterkenntnis erhalten, darf man sich dagegen aber nicht wehren. Es mag nun die Frage aufkommen, warum man dann überhaupt das Ziel, Selbsterkenntnis zu gewinnen, verfolgen sollte. Selbsterkenntnis eröffnet neue Sichtweisen auf sich selbst und auf die Welt und bietet damit verschiedene Möglichkeiten, an sich selbst zu arbeiten. Mehr Aufschluss über diese Frage erhalten wir allerdings, nachdem wir uns angeschaut haben, wie Selbsterkenntnis nun eigentlich gelingt. Um wirkliche Selbsterkenntnis erlangen zu können, muss man sich vor allem viel Zeit für sich selbst nehmen. Diese Zeit sollte allein und in Ruhe verbracht werden, um herausfinden zu können, wer man wirklich ist. In dem Prozess sollte man sich nicht von anderen leiten oder gar bevormunden lassen.
Dabei spielt Selbstreflexion eine wichtige Rolle. Man muss sich selbst hinterfragen und sein Verhalten reflektieren. Warum handle ich so, wie ich handle? Was will ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Wieso fühle ich das, was ich fühle? Was bewegt mich? Um zu ergründen, wer man ist, was für ein Mensch man ist und was man selbst will, muss man herausfinden, welche Wünsche, Hoffnungen, Ziele, Bedürfnisse, Ängste, Befürchtungen und Sorgen man hat. Es sollten Stärken und Schwächen erkannt werden. Wir müssen Gründe suchen, die unser Handeln und unsere Denkweise bestimmen. Auffälliges Verhalten, wie beispielsweise Reizbarkeit in unauffälligen Momenten, sollte analysiert werden, in dem man sich die Fragen stellt, warum man so reagiert und woran das liegt, um sich von negativen Faktoren lösen zu können. Das trägt zu einem achtsameren Umgang miteinander bei und so bekommen auch andere die positive Energie der Selbsterkenntnis zu spüren.
Es sollte aber unbedingt beachtet werden, welche Wünsche man selbst hat und welche unter Einfluss anderer entstehen. Jeder Mensch wird, wenn auch nur im entferntesten, von der Frage beeinflusst: ,,Was will ich, was andere über mich denken?”. Zu viele Menschen handeln danach und davon sollte man sich unter anderem bei der Selbsterkenntnis lösen. ,,Was denken andere von mir und beeinflusst das mein Handeln?” sind damit Fragen die auf der Reise zur Selbsterkenntnis dringend beantwortet werden sollten. Der Philosoph Ralph Waldo Emerson sagte dazu folgendes: ,,Du selbst zu sein, in einer Welt, die dich ständig anders haben will, ist die größte Errungenschaft”. Dies ist meiner Meinung nach wahr. Sich vom Einfluss anderer zu lösen und die Gleichgültigkeit darüber, was sie von einem denken und stattdessen seine Bedürfnisse auszuleben, erfordert viel Mut und viel Kraft. Das ist jedoch wichtig, wenn man nach seinen eigenen Vorstellungen leben will, denn nur so kann man sich selbst glücklich machen. Und das erfordert Selbsterkenntnis.
Meditation kann ein hilfreiches Mittel sein, wenn man Selbsterkenntnis bekommen möchte. ,,Meditieren” kommt aus dem lateinischen und heißt so viel wie ,,Nachdenken”. Meditation bietet viel Zeit für einen selbst, in vollkommener Stille und ohne Ablenkung. Man wird also gezwungenermaßen mit sich selbst konfrontiert und kann sich somit selbst besser kennen lernen. Meditieren übt darin, über nichts nachzudenken, als das Hier und Jetzt und einen klaren Kopf zu bekommen, durch den Fokus auf den eigenen Atem und den eigenen Körper. Das bietet eine ideale Grundlage, für den eben beschriebenen Prozess der Selbstreflexion, der am besten gelingen kann, wenn man voll und ganz auf sich selbst konzentriert ist. Zudem ist Meditation förderlich für das Finden einer ,,inneren Ruhe”, die uns hilft gelassener zu sein und viel Stress aus dem Alltag für einen Augenblick zu vergessen. Damit kann das Verfahren der Suche nach Selbsterkenntnis vereinfacht werden, weil man sich so besser auf sein Inneres konzentrieren kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man durch das Meditieren lernt konzentriert und entspannt zu sein, was zum Finden der Erkenntnis über einen selbst beitragen kann.
Sigmund Freud war der Meinung, dass Träume das Unterbewusstsein des Menschen widerspiegeln und man durch Träume vieles über im Unterbewusstsein verborgene Bedürfnisse erfahren kann. Diese Anschauung vertrete ich ebenfalls und somit ist für mich eine weitere Möglichkeit Selbsterkenntnis zu erlangen das Deuten von Träumen. Träume geschehen unterbewusst, da man sie selbst nicht steuern kann. Erinnert man sich an einen Traum, ist das Deuten verschiedener Elemente des Traums, eine Methode zu ergründen, was in seinem Unterbewusstsein vor sich geht. Auf diese Weise können sich essentielle Wünsche und Ängste herausstellen, die man vorher eventuell nicht erkannt oder verdrängt hat.
Neurowissenschaftler würden mir an dieser Stelle vermutlich widersprechen, glauben sie doch, Träume wären lediglich aneinander gereihte Bilder des Gehirns und die Erinnerung an das Geträumte wäre bloß eine Interpretation dieser Bildfolge. Mir persönlich stellt sich hierbei allerdings die Frage, woher diese Bilder stammen sollten und wann man die Interpretation dieser Bilder vornimmt, da man am Morgen ja glaubt alles detailgetreu zu wissen und nicht beginnt zu deuten. Ich glaube, dass Träume unterbewusste Gefühle zum Ausdruck bringen und unser Körper auf diesem Weg versucht uns mitzuteilen, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Meine These, dass das Deuten von Träumen zur Selbsterkenntnis beitragen kann, ist also nicht bewiesen. Ich glaube indes, dass es funktionieren kann, solange man selbst daran glaubt. Ich glaube daran und konnte durch das Ergründen meiner Träume vieles über mich selbst erfahren.
Doch weshalb sollte man diesen ganzen Aufwand betreiben? Was nützt es, Selbsterkenntnis zu haben, wenn dies das ganze Selbstbild verändert? Welchen Vorteil zieht man daraus, sich selbst zu verstehen?
Wie bereits erwähnt, ermöglicht Selbsterkenntnis es uns, die Welt und uns selbst mit anderen Augen zu sehen. Dadurch erhalten wir die Option an uns selbst zu arbeiten. Etwas verändern kann man nur, wenn man es erkennt. Erkennt man durch seine Selbsterkenntnis beispielsweise, dass man sich ein Leben lang von anderen Menschen hat beeinflussen lassen und nicht nach dem gehandelt hat, was man eigentlich für richtig hält, so kann man es im Nachfolgenden ändern und sich davon lösen. Es erfordert dahingehend Mut, seine wahren Ziele zu verfolgen und Bedürfnisse zu befriedigen. Der Vorteil ist, man lebt nach seinem eigenen Leitbild, so wie man es selbst für richtig hält. Es ist nur möglich es zu wagen, seine innersten Bedürfnisse auszuleben, wenn man diese auch wirklich kennt. Neu entdeckte Stärken können gefördert werden und so lernt man auf eine Art zu leben, die besonders die positiven Seiten, von einem selbst, zum Vorschein bringt.
Auch Ängste können nur überwunden werden, wenn sie offenbart worden sind. Und die Erkenntnis über uns selbst kann viele unterbewusste Ängste aufdecken, mit denen es dann gilt sich auseinanderzusetzen. Daraus resultiert persönliches Wachstum, weil man an sich selbst arbeiten und sich weiterentwickeln kann, wenn man sich persönlich zu 100% kennt. Mithilfe der Selbsterkenntnis kann man seine Stärken und Schwächen einschätzen und erhält dadurch die Motivation seine Stärken zu verbessern, beziehungsweise auszuweiten, und lernt mit Kritik umzugehen. Man lernt die persönlichen Limits kennen, beispielsweise in Streitgesprächen, was dabei helfen kann, mit Rückschlägen umzugehen und diese zu verarbeiten.
Selbsterkenntnis offeriert einem also die Möglichkeit, das Leben zu leben, das man sich tief in seinem Innersten wünscht, auch wenn das eine Menge Arbeit und Entwicklung erfordert. Mit der Zeit schafft man es, sein neues Selbstbild zu akzeptieren und auf die Selbstakzeptanz aufbauend folgt die Selbstliebe. Damit ist Selbsterkenntnis der Schlüssel für Zufriedenheit und das eigene Glück, das durch Ausleben eigener Interessen erreicht wird. Auf diese Weise steigern sich das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein, was bei anderen Menschen einen positiven und sympathischen Eindruck hinterlässt. Kennt man sich selbst und hat verstanden an sich selbst zu arbeiten, so weiß man, welch besonderer Mensch man ist und kann dies in Form des Selbstbewusstseins nach außen hin präsentieren.
Inspirierende Worte zum Zweck der Selbsterkenntnis lieferte mir der Schriftsteller Stefan Zweig: ,,Wer sich einmal selbst gefunden hat, der kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren”. Dieses berührende Zitat, ermutigt mich persönlich dazu, die Suche nach mir selbst zu wagen und ich denke stark, dass sich auch andere von diesen Worten ergreifen lassen. Der Gedanke, mich selbst zu finden und dadurch mein Glück zu finden und mein Leben nach meinem Belieben zu gestalten, geht mir sehr zu Herzen. Selbstverständlich können mir Dinge auch dann noch verloren gehen, jedoch nichts Grundlegendes, das ich zu meinem Glück bräuchte oder mir zu einer tiefen inneren Zufriedenheit fehlen würde. Mein Charakter, der mir durch die Selbsterkenntnis erleuchtet wird, wird mir immer bleiben.
Quellen:
https://www.gluecksdetektiv.de/5-unschlagbare-gruende-noch-heute-mit-dem-meditieren-zu-beginnen/
https://www.aphorismen.de/zitat/191693
https://zitatezumnachdenken.com/ralph-waldo-emerson/10469
Florian Wejda: Die Person sein, die wir bewundern und immer sein wollten
In seinem Text unternimmt Florian das Wagnis, den Begriff der Selbsterkenntnis zu analysieren sowie mit psychologischen Experimenten, abstrakten Konzepten und mythologischen Geschichten zu veranschaulichen. Er beginnt mit dem „Gorilla-Experiment“ und zieht daraus den Schluss: Ich sehe, was einen Wert für mich hat. Analog dazu zeigen ihm unsere Handlungen, welche Werte wir schätzen und welche wir verabscheuen. Nach dem Schweizer Psychoanalytiker C.G.Jung bilden jene unseren „Gott“, diese unseren „Schatten“. Florian zufolge geht es also bei der von ihm favorisierten Selbsterkenntnis nach Jung letztlich darum, dem eigenen Gott möglichst gut gerecht zu werden.
Was haben ein Gorilla, das menschliche Auge, eine Maus und eine babylonische Gottheit gemeinsam? Selbsterkenntnis? Was auf den ersten Blick sehr willkürlich erscheint, versuche ich in diesem Essay in einen Kontext zu bringen. Am Beginn eines jeden Textes muss man sich im Klaren sein, worüber man eigentlich schreibt. Wenn ich mir jetzt das Wort „Selbsterkenntnis“ anschaue, ist es essentiell das „Selbst“, sowie „Erkennen“, zu definieren. Ebenfalls muss ich mir ein Ziel setzten. Probiere ich jetzt eigene tiefgründige Ideen und Konzepte zu entwickeln oder probiere ich eine vorher formulierte Idee von Philosophen und Psychologen, so gut es geht, zu verstehen? Von der Analyse und Herausarbeitung welcher Idee, meiner eigenen oder einer fremden, werde ich am Ende mehr profitieren? Ich bin überzeugt, dass, bevor ich den Versuch wage, komplexe Konzepte mit Hand und Fuß zu produzieren, lieber den Fokus auf Ideen lege, die von Personen stammen, deren Jon es nicht nur war, jene zu produzieren, sondern die damit auch noch weltberühmt wurden. Das bedeutet, ich werde in meinem Essay probieren, eine Begriffsanalyse zu verfassen und diese mit psychologischen Experimenten, abstrakten Konzepten und mythologischen Geschichten zu veranschaulichen.
Was also heißt es etwas zu erkennen? Um der Frage des Erkennens auf den Grund zu gehen, muss man sich erst einmal fragen, wie man sieht. Natürlich liegt es auf der Hand, dass man mit den Augen sieht, aber Augen sind durch das gesamte Tierreich hindurch unterschiedlich und im Evolutionsprozess. Also was genau ist unser Auge fähig zu sehen? Die ersten Lebewesen konnten durch ihre Augen nur Licht und Dunkelheit unterscheiden. Anschließend fing die Netzhaut an sich zu wölben und man konnte erkennen, von wo das Licht kam. Mit der Zeit konnte man verschiedene Intensitäten ausmachen, d.h. auch Schatten erkennen. Langsam, aber sicher krümmte sich das Auge immer weiter und immer weniger Licht konnte durch die Pupille gelangen. Das führte einerseits dazu, dass wir einen kleinen Ausschnitt dessen, was wir sehen, unglaublich scharf sehen, der Rest aber nur noch vage wahrgenommen wird. Alles was wir sehen, sehen wir in unserem Kopf. Das Auge nimmt nur Licht aus verschiedenen Richtungen wahr. In unserem Kopf wird es verarbeitet und kontextualisiert. Dies ist der Grund, warum wir optischen Täuschungen erliegen. Der Fehler liegt nicht im Auge, sondern im Gehirn. Da unser Gehirn aber in unserem Kopf Platz finden muss, kann unser Sehzentrum nicht riesig werden, um unsere Umgebung mit derselben Schärfe abzubilden, wie wir es mit einem kleinen Ausschnitt tun, oder jede optische Täuschung als Täuschung zu identifizieren. Die Evolution hat gezeigt, dass Menschen mit riesigen Sehzentren und entsprechenden Köpfen sich nicht lange gehalten haben. Der Mensch hat also gelernt, sich in der Welt zu orientieren, indem er nur einen kleinen Ausschnitt wahrnimmt. Das bedeutet aber auch, dass man sich entscheiden muss, meist unterbewusst, was man sehen will. Wenn man diese Entscheidung getroffen hat, ist man blind für alles andere. Natürlich ist das nur eine Vermutung und bedarf Beweisen. Das 1999 durchgeführte Experiment „der unsichtbare Gorilla“ beweist genau das. Christopher Chabris und Daniel Simons wollten in einem Test zeigen, dass unser Sehen selektiv und uns oftmals nicht bewusst ist. Probanden sollten sich ein kurzes Video anschauen, in welchem sich sechs Personen, drei in Weiß und drei in Schwarz, sich einen Ball zuwerfen. Man sollte nun zählen, wie oft sich das weiße Team den Ball zuwirft. Nach der Hälfte der Zeit läuft eine Person als Gorilla verkleidet von rechts nach links durch das Bild, wobei er auf halbem Weg stehen bleibt und sich für fünf Sekunden auf der Brust herumtrommelt. Nach dem Video wurde gefragt, ob man einen Gorilla gesehen hätte, wenn einer durchs Bild laufen würde. Fast jeder antwortete mit „ja, natürlich hätte ich“. Als dann aber gefragt wurde, wie viele einen Gorilla gesehen haben, war das Ergebnis verheerend. Die Hälfte aller Probanden, welche das Video sahen und die Würfe zählten, hatte keinen Gorilla gesehen! Sie waren so auf das Zählen der Würfe fokussiert, dass sie einen Gorilla in Menschengröße übersahen.
Was genau zeigt uns dieses Experiment? Es zeigt uns, dass sobald wir eine Sache mit einem Wert versehen haben, in diesem Fall das Zählen der Pässe, der Rest aus unserem Blickfeld verschwindet. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass dieses Prinzip, ich sehe nur, was einen Wert für mich hat, nicht auch auf unser tägliches Leben übertragen werden kann. Ergo, wenn ich erkenne, was ich sehe, wird mir bewusst, was einen Wert für mich hat. Jenes Reflektieren des Gesehenen ist eine Fähigkeit, die die Menschheit über Jahrtausende als elementar für ein sinnvolles Leben empfunden hat. Die unermessliche Wichtigkeit, dass das Gesehene erkannt werden kann, spiegelt sich in den Göttern vieler Hochkulturen wider. Die babylonische Gottheit Marduk wurde als die ideale Form des Menschen gesehen. Er schaffte es, alle damaligen Götter zu vereinen, mit ihm an der Spitze. So wundert es wenige, dass Marduk in vielen Abbildungen mit einer Krone voller Augen gezeigt wurde. Genau jene Augen, die dazu notwendig sind, etwas zu erkennen. Die Fähigkeit, alles erkennen zu können, wurde dem Gott der Götter zugeschrieben. Ein größerer Beweis für die Wichtigkeit des Erkennens ist kaum vorstellbar.
Doch wie genau kann man diese Theorie jetzt mit dem Selbst in Verbindung bringen? Was genau lässt sich erkennen, das Aussagen über das Selbst treffen könnte? Wohl doch unsere Handlungen. Unsere Worte sind wenig nützlich. Wie oft ertappen wir uns, bei dem Versuch uns etwas einzureden. Aber Handlungen, Handlungen sind die unverfälschten Äußerungen des Selbst. Ich sehe, was für mich einen Wert hat. Wenn ich erkenne, was ich sehe, kann ich erkennen, was einen Wert für mich hat. Dasselbe Prinzip lässt sich bei unseren Handlungen anwenden. Wenn ich meine Handlungen analysiere, kann ich erkennen, was für mich einen Wert hat. Es entsteht eine Form, eine Pyramide von Werten: das „Selbst“. Unsere Handlungen sind anders als unsere Worte ehrlich zu uns. Sie lassen uns erkennen, welche Werte man schätzt und welche nicht. Aus diesen Werten wird ein ideales Bild von uns erstellt. Dieses Ideal ist unser „Gott“, ob man ihn nun so nennen mag, sei dahingestellt. Doch selbst ein Atheist kann die Existenz dieses Ideals nicht leugnen. Dieses Ideal ist alles, was man sein kann, das „Potenzial“ des „Ich“. Das „Ich“ ist alles, was man war und ist. Jenes Konzept wurde bereits von dem großen Schweizer Psychoanalytiker C.G. Jung zu Papier gebracht. Das „Ich“ in Kombination mit dem „Potenzial“ wird zum Selbst. Also ist Selbsterkenntnis anders als Selbstbewusstsein, ein Prozess über die Zeit anstatt die Beschreibung von dem Bewusstsein des „Ich“ in einem bestimmten Moment. Ich stelle mir dieses Konzept folgendermaßen vor:
Das „Ich“ bewegt sich, über die Zeit, auf einer Linie. Durch unsere Handlungen beeinflussen wir, ob sich das „Ich“ unserem „Gott“ annähert oder entfernt. Handeln wir in Übereinstimmung mit unseren Werten, die unseren „Gott“ charakterisieren, so nähern wir uns ihm an. Tun wir dies nicht, entfernen wir uns wieder. Nun stellt sich allerdings die Frage, „Wohin man sich entfernt?“
Der „Schatten“. Der „Schatten“ ist ebenfalls ein Konzept von C.G Jung und in der Wichtigkeit seiner Entdeckung nicht zu überschätzen. Menschen sind zu Unmenschlichem fähig, niemand bestreitet das. Dennoch mag jeder von sich glauben, selbst in den unmenschlichsten Verhältnissen ein Leuchtfeuer des „Guten“ zu sein. Dabei gibt es keinen Grund anzunehmen, nicht selbst zu Unmenschlichem fähig zu sein. Jeder Mensch hat einen „Schatten“, die grauenhaften, unmenschlichen und bösartigen Verlangen liegen in unserer Natur. Nur weil man dieses Verlangen nicht verspürt, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Vielleicht war man nur nie in einer Situation, wo es einen Nachteil gebracht hätte, „gut“ zu handeln. Von Terenz, einem römischen Dichter, stammen die Worte, „Ich bin ein Mensch. Nichts Menschliches ist mir fremd.“ Ich habe lange gebraucht um zu verstehen, was genau damit gemeint ist, aber ich glaube ich konnte den Gedanken zumindest für mich präzisieren. Was ist das Grausamste, das ich mir als Zustand vorstellen kann? Wenn ich mir die Geschichte anschaue, ist das 20. Jahrhundert geprägt von Grausamkeit. Doch wie kommt ein Mensch dazu, unschuldige Mitmenschen zu foltern und hinzurichten, wie es in den NS-Konzentrationslagern sowie den sowjetischen Gulags geschah? Waren jene Aufseher einfach von Geburt an schlechtere Menschen? Nein, diese Antwort ist zu naiv um wahr zu sein. Jedoch ist es so abstrakt, sich selbst als Aufseher vorzustellen. Alles ist eine Frage der Perspektive. Natürlich fällt es mir leicht, diese Vorstellung als realitätsfern abzustempeln, aber doch nur, weil meine Realität eine andere ist. Ich bin durch meine Lebensstandards nicht in einer Position, jene Handlungen zu erwägen. Doch jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten gerade den Terror des ersten Weltkrieges in den Gräben erlebt. Sie sind traumatisiert, sie sind arbeitslos und ohne Geld. Ihre Familie muss unglaublichen Hunger leiden. Frust staut sich in Ihnen auf und entwickelt sich zu Wut. Sie fangen an, ihren „Schatten“ auszuleben und merken, wie sich ihr Leben für sie zum Besseren entwickelt. Jedoch geschieht dies nur relativ, da sich ihr Leben nicht wirklich verbessert. Das Einzige, was durch dieses Verhalten erreicht wird, ist, dass Sie ihre Position des Leidens mit jemand anderem getauscht haben, indem sie ihm größeres Leid zufügen.
Jeder, der immer noch abstreitet, einen „Schatten“ zu besitzen, ist entweder nicht ehrlich zu sich oder naiv. Es als Naivität abzutun, wird der Sache allerdings nicht gerecht. Wenn wir zurück auf unser Konstrukt des „Selbst“ blicken, haben wir geklärt, dass oberhalb des „Ich“ unser „Gott“ liegt und unterhalb der „Schatten“. Wenn Sie aber dem „Schatten“ die Existenz verleugnen, kann dies verheerende Konsequenzen mit sich ziehen. Zu glauben, dass jeder Mensch nach dem „Guten“ strebt, haben wir bereits als Irrtum identifiziert. Nur weil man sagt, es gibt etwas nicht, verschwindet es nicht. Das heißt, wenn sich das grauenhafte Element des „Selbst“ veräußert, wird es Sie traumatisieren. Sie haben in ihrer Wertestruktur des „Selbst“ keinen Platz für jene Handlungen. Es wird ihr Fundament des „Selbst“ in seinen Grundfesten erschüttern, wenn nicht sogar zum Einsturz bringen. Damit so etwas allerdings nicht passiert, bedarf es keiner Verteuflung sondern einer Integration des „Schattens“. Ich muss mir in meinen Handlungen bewusst sein, zu welchem Schrecken ich in der Lage bin. Dass ich meine Realität zur „Hölle auf Erden“ machen kann. Ich muss mir überlegen, wie würde mein Leben in fünf Jahren aussehen, wenn ich meine Mitmenschen ausnutze, belüge und betrüge. Wenn ich am Ende die Entscheidung treffe, mich jenem Verlangen nicht hinzugeben, habe ich meinen „Schatten“ integriert.
Doch wie bringt man die Idee des „Erkennens“, also das Bewusstwerden der intrinsischen Werte und das „Selbst“, mit seiner pyramidenartigen Struktur des „Gott“ im Himmel und des „Schattens“ in der Hölle mit dem „Ich“ dazwischen, zusammen? Wie kommt man von dort auf „Selbsterkenntnis“? Klar ist, zu „Selbsterkenntnis“ gehört jenes Erkennen des „Selbst“, das heißt, man erkennt seine eigene Wertestruktur. Doch „Selbsterkenntnis“ ist mehr. Immerhin beschreibt es einen Prozess über Zeit, also die Verschiebung des „Ich“ nach oben oder unten. Doch durch die Integration des „Schatten“ entsteht das Bild einer nicht erstrebenswerten Zukunft und ermöglicht die Chance auf Veränderung. Welcher weitere Gedankenschritt kann auf die „Chance zur Veränderung“ folgen?
Man kann die Motivation von Ratten messen, indem man sie an einen Strick bindet und auf etwas Begehrtes zurennen lässt. Eine hungrige Ratte wird mit Kraft x an dem Seil ziehen, wenn sie auf ein Stück Käse zuläuft. Sprüht man in das Gehege nur die Duftnote einer Katze, probiert die Ratte der Katze zu entkommen und zieht ebenfalls mit Kraft x an dem Seil. Die Ratte ist also motiviert, einen bestimmten Zustand (Sattsein) zu erreichen und einem bestimmten Zustand zu entkommen (Tod). Die Ratte zieht jeweils mit einem x am Seil, doch addiert man beide Zustände wird die Ratte mit zwei x an dem Seil ziehen. Sie ist also doppelt so motiviert. Dies ist natürlich nur eine Metapher für die eigene „Selbsterkenntnis“. Erkenne ich meinen Käse, also mein erstrebenswertes Ziel, bin ich motiviert, jenes zu erreichen. Erkenne ich noch dazu meine Katze, also meinen „Schatten“, bin ich motiviert, ihm zu entkommen. Diese Art von Analyse ermöglicht es, „Selbsterkenntnis“ als Beschreibung der intrinsischen Motivation, ein „gutes“ Leben führen zu wollen, anzusehen. „Selbsterkenntnis“ ermöglicht uns, die Person zu sein, die wir bewundern und immer sein wollten. Durch „Selbsterkenntnis“ wird jedes Individuum zu einer unglaublichen Kraft des „Guten“ in der Welt.
Quellen:
1)Terenz Zitat
https://www.aphorismen.de/zitat/24341
2) C.G. Jung Schatten und Ich
https://de.wikipedia.org/wiki/Schatten_(Archetyp)
3) der unsichtbare Gorilla
http://theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html
4) Marduk, Gestalt
5) Entwicklung des Auges
https://de.wikipedia.org/wiki/Augenevolution
Berrin Yetiskin: Nimm dir Zeit für dich selbst!
Berrin unterzieht unsere Gesellschaft einer heftigen psycho-sozialen Kritik. Der Begriff des oberflächlichen Handelns dient ihr als Leitfaden bei der Aufdeckung entindividualisierender, deformierender und krank machender Tendenzen in unserer gnadenlosen Leistungsgesellschaft. Der allgegenwärtige Utilitarismus ignoriert, was unser Leben menschlich, angstfrei und selbstbestimmt machen könnte: die Reflexion auf das eigene Handeln und Wollen. An Kants moralisch definierten Begriff der Selbsterkenntnis knüpft sich Berrins kontrafaktische Hoffnung, dass reflexive „Auszeiten“, die wir so nötig haben, heute noch möglich sind.
Sich von seinen Mitmenschen nicht verstanden fühlen, denken, man würde die gesamte Zeit über ausgeschlossen werden, aus Selbstschutz die Flucht innerhalb der Gesellschaft ergreifen, sich mit genau dieser Gesellschaft nicht mehr identifizieren können, sich einsam fühlen und mit einer gefühlt unendlich großen Leere zurückbleiben – wer von uns kennt nicht mindestens einen dieser Eindrücke, Gedanken und Gefühle?
Wir leben in einem Zeitalter, in dem besonders stark hervorsticht, wie sehr und auch schnell sich unsere Gesellschaft in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt. Meiner Meinung nach lässt sich diese ganz bestimmte Richtung durch das oberflächliche Handeln des Menschen kennzeichnen. Dass oberflächliches Handeln und somit auch die Oberflächlichkeit, an sich der Ausdruck von etwas Negativem ist und dass durch die Verwendung dieses Begriffes auch Kritik an unserer heutigen Gesellschaft ausgedrückt wird, ist mir durchaus bewusst. Denn meiner Meinung nach ist es auch vollkommen berechtigt, das heutige Wesen unseres gemeinsamen Miteinanders zu kritisieren. Es ist zum einen berechtigt, diesbezüglich Kritik auszuüben, da das Individuum des Menschen immer mehr in den Hintergrund fällt, an Bedeutung verliert und mit der Zeit so abstrakt wird, dass selbst die Vorstellung seiner Existenz nicht mehr real erscheint. Zum anderen jedoch auch deswegen, da diese beschriebene Tatsache den meisten unserer Mitmenschen nicht einmal auffällt und sie selbst diejenigen sind, die ihrem Individuum einen immer kleineren Wert verleihen.
Menschen, die sich heutzutage aktiv mit dem Sinn des Lebens auseinandersetzen, sich wirklich noch die Zeit dafür nehmen und sich Gedanken darüber machen, sich selbst die Frage stellen, wer sie sind und was genau sie anstreben, aus moralischer sowie menschlicher Sicht als Person und somit auch als Individuum zu sein, werden gefühlt nur noch belächelt und nicht richtig ernst genommen. Ihnen wird gesagt, sie hätten viel zu viel Zeit oder könnten in der Zeit, die sie mit solch unnötigen Gedanken verbringen, so viel an anderen Sachen schaffen, ihre eigentlichen Ziele erreichen und um Einiges produktiver sein. Doch entspricht dies wirklich der Wahrheit? Kann man hierbei wirklich von einer verschwendeten Zeit sprechen? Ist der Mensch produktiver, wenn er seine Ziele pausenlos verfolgt, ohne wirklich darüber nachzudenken und dabei auch keinerlei Reflexion über sein eigenes Machen und Tun zu besitzen? Inwiefern ist es berechtigt, Gedanken über den Sinn des Lebens und über sich selbst als Person als unnötig zu bezeichnen?
Hierbei würde ich zunächst erst einmal gern mit der Beantwortung der letzten Frage beginnen, denn meiner Meinung nach ist es in keiner Weise berechtigt und nachvollziehbar, Gedanken bezüglich des eigenen Handelns und bezüglich des eigenen Seins als unnötig zu bezeichnen. Aus dieser Antwort ergibt sich somit im Grunde genommen auch die Antwort der restlichen Fragen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass jedem von uns bewusst ist, dass das eigene Handeln und Sein zu reflektieren, sich somit auch in gewissem Maße eine Auszeit zu nehmen, uns alle um Einiges weiterbringen würde und sich dadurch erst wirklich Produktivität und Zielstrebigkeit steigern lassen würden. Wenn es sich hierbei also fast schon um eine Selbstverständlichkeit sowie auch eindeutige Tatsache handelt, ist doch im Grunde genommen die einzige Frage, die einem selbst gestellt werden sollte, die, wieso es denn nicht als solche angesehen und am Ende auch umgesetzt wird, oder?
Unsere heutige Gesellschaft akzeptiert Auszeiten jeglicher Art nicht mehr, sie entsprechen nicht den gewünschten Anforderungen und stellen nach unserem heutigen Verständnis nur noch das persönliche Scheitern dar. „Jung, erfolgreich und glücklich“, dieses Denken erfüllt wiederum den heutigen Anforderungsbereich, wobei auch hervorsticht, dass Erfolg und Glück nur in einer Weise richtig interpretiert sowie verstanden werden können. Man kann nur von einem glücklichen sowie erfolgreichen Leben sprechen, wenn es dem Glück und dem Erfolg der Mehrheit entspricht. Dies wiederum heißt so schnell wie möglich im Leben anzukommen, seine Ziele zu erreichen und den Interessen seiner Mitmenschen entgegenzukommen. Es geht also schon lange nicht mehr darum, sich selbst kennen zu lernen, sich die dafür benötigte Zeit zu nehmen und sich somit auch seiner eigenen Ziele ganz konkret bewusst zu werden. Es geht, so ist es anzunehmen sowie zu beobachten, einzig und allein nur noch darum, mit der begrenzten uns zur Verfügung gestellten Zeit umzugehen, um somit im Prinzip das Unmögliche möglich zu machen. Das Unmögliche möglich machen, beschreibt den vorliegenden Sachverhalt daher auch ziemlich passend sowie treffend, da nicht anders denkbar ist, wie, wenn kaum noch genug Zeit gegeben ist, immer weiter mehr Zeit geschaffen werden soll.
Das Leben innerhalb der Gesellschaft verleitet uns Menschen also dazu, auf unsere Selbsterkenntnis zu verzichten, uns aber dennoch immer weiter sowie stärker dem Druck der extremen Zielstrebigkeit auszusetzen. Es wird von uns erwartet, unsere komplette Kapazität auszunutzen und dabei keinerlei Rücksicht darauf zu nehmen, ob diese vielleicht schon vollkommen aufgebraucht ist. Dasjenige, was am Ende zurückbleibt, macht sich bei uns Menschen dann meistens als „mental health problems“ in Form von Depressionen bemerkbar, welche häufig verbunden sind mit gesellschaftlichem Rückzug und einer gewissen Einsamkeit. Doch auch dies wird von einem großen Teil der Mehrheit nicht weiter beachtet und als nicht relevant angesehen, da es ja nur „bloße Kopfsache“ sei und man sich das meiste somit auch eigentlich nur einbilde. Dass es sich hierbei um besonders starke sowie wichtige Warnsignale handelt, die darauf aufmerksam machen sollen, dass innerhalb des gesellschaftlichen Systems etwas nicht wirklich seiner Richtigkeit entspricht, wird ganz und gar außer Betracht gelassen, was so gesehen im Endeffekt auch für eine gewisse Ironie sorgt. Der Grund, weshalb ich hierbei dazu tendiere, genau von solch einer Ironie zu sprechen, ist, dass die meisten Menschen, wenn auch vollkommen unbewusst, auf ihre Selbsterkenntnis sowie Selbstreflexion verzichten, um stets einen Teil der Gesellschaft darstellen zu können und somit auch ihrer Angst vor der Einsamkeit zu entfliehen. Leider scheint es jedoch nur so, als würden sie dieser Einsamkeit entfliehen können, da sie in Wirklichkeit damit bewirken, sich dieser immer weiter zu nähern und sich somit auch innerhalb der Gesellschaft einsam zu fühlen. Dass diese Angst besteht und der Mensch dazu tendiert sowie auch stets bevorzugt, dieser Angst zu entkommen, ist meiner Meinung nach vollkommen nachvollziehbar, da bereits die Evolutionsbiologie zeigt, dass der Mensch dazu veranlagt ist, in Gruppen zu leben und diesen zu folgen, um sich somit auch sein eigenes Überleben sichern zu können. Heutzutage endet dies aber nur noch genau damit, dass der Mensch auf sich selbst als Individuum verzichtet, jegliche Selbsterkenntnis verliert und daher beispielsweise auch nicht einmal bemerkt, die stets gefürchtete Angst gerade durch sein eigenes Verhalten zu verstärken.
Dass dies jedoch keinesfalls so sein sollte, wird unter anderem auch durch die Aussagen und Schriften Immanuel Kants sehr deutlich, welcher sich ebenso zu dieser Thematik äußerte. Denn Kant beschreibt, dass Selbsterkenntnis das oberste Gebot aller Pflichten gegen sich selbst sei und jeder Mensch sich somit selbst erkunden, erforschen sowie ergründen solle und dies nicht nach der physischen Vollkommenheit, sondern nach der moralischen Vollkommenheit des Menschen in Beziehung auf seine Pflicht. Daher bezeichnet er die moralische Selbsterkenntnis auch als den Anfang aller menschlichen Weisheit und setzt diese auch gleich in Verbindung mit dem guten Willen. Der gute Wille ist nach Kant in jedem menschlichen Wesen bereits gegeben, muss sich jedoch erst noch entwickeln und somit auch ausgebaut werden. Diese Entwicklung wird seiner Meinung nach durch die Selbsterkenntnis ermöglicht, welche daher auch als Grundlage gegeben sein muss. Auch Arthur Schopenhauer, ein deutscher Philosoph, Autor und Hochschullehrer, welcher sich selbst auch als Schüler und Vollender Kants sah, fasste die Selbsterkenntnis als die Einsicht in das eigene Wollen zusammen und verlieh dieser somit ebenfalls oberste Priorität. Er war fester Überzeugung, dass ein Mensch wissen müsse, was er will und was er könne, da dieser, ihm zu Folge, erst dann Charakter zeigen werde und auch erst dann Rechtes vollbringen könne.
Bei der Selbsterkenntnis handelt es sich also darum, Erkenntnis über seine eigene Person im Hinblick auf bestimmte Fähigkeiten sowie aber auch Fehler und Defizite zu erlangen. Vielleicht ist auch genau dies der Grund weshalb die Mehrheit der Menschen, bewusst sowie aber auch unbewusst, auf jegliche Art der Selbsterkenntnis verzichtet um somit einer viel größeren Angst zu entkommen, welche wiederum beinhaltet, sich seinen eigenen Fehlern und Defiziten direkt stellen zu müssen. Dass es nichts Einfaches ist, sich seinen eigenen Fehlern und Mängeln zu stellen und des Öfteren auch viel Überwindung sowie Mut benötigt, ist nichts großartig Neues. Jedoch ist es äußerst fragwürdig, ob dies Grund genug dafür ist, somit auch auf einen Teil seiner eigenen Freiheit zu verzichten und sich selbst stattdessen einem auf Oberflächlichkeit beruhenden gesellschaftlichen System zu überlassen. Denn die Selbsterkenntnis stellt das Sprungbrett der Freiheit dar, da der Mensch nur wirklich frei sein kann, wenn er sich selbst zunächst einmal erforscht hat. Auch die alten Griechen begriffen, dass diese Art des Kennenlernens der eigenen Person zu einem Persönlichkeit bildenden und Persönlichkeit schaffenden Element wird.
Was also bleibt uns Menschen am Ende wenn wir vor lauter Angst, welcher wir uns zu stellen fürchten, die Flucht ergreifen und somit auf das Wertvollste unseres eigenen Wesens, auf uns als Individuum, verzichten? – Nichts. Wir Menschen nehmen uns somit selbstständig unsere Freiheit weg und verstärken unsere gedanklichen Hindernisse, mit der eigentlichen Intention, alles einfacher und bequemer zu machen. Doch genau dieser Drang nach Bequemlichkeit ist es, was den Menschen ständig dazu verleitet, in einem Trugbild seines Eigenen zu leben ohne es dabei in irgendeiner Weise zu bemerken. Anstatt ständig vor Ängsten wie der Einsamkeit zu flüchten und sich somit Trugbildern wie der Oberflächlichkeit zu überlassen, ist es meiner Meinung nach sinnvoller, sich die Zeit, die nicht gegeben ist, zu schaffen und somit das Unmögliche möglich zu machen, jedoch dieses Mal ganz allein für sich selbst und für niemand anderen.
Erforsche dich selbst, lerne dich selbst kennen, fliehe nicht vor deinen Ängsten, stelle dich ihnen und lass dich nicht von der Mehrheit bestimmen und charakterisieren, nehme dir Zeit für dich, definiere dir selbst die Begriffe Glück und Erfolg im Leben und zu guter Letzt, nicht zu vergessen, WERDE, DER DU BIST!
Quellen:
https://www.textlog.de/32611.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=Schopenhauer
http://www.philosophische-praxis.at/selbsterkenntnis.html
Die Ausschreibung
Ausschreibung und Einladung zum
8. HCG-Philo-Wettbewerb
Selbsterkenntnis
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCG-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung sind. So sollen bevorzugt Themen bearbeitet werden, die entweder sehr aktuell sind, z.B. Atomkraft, oder im Interessenshorizont vieler Schülerinnen und Schüler liegen, z.B. Computer. Zu erstellende Produktarten sollen nicht die im Regelunterricht geforderten Standardformen von Analyse, Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc.; Thema und Produktart werden jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Buchpreise werden dankenswerterweise vom Förderverein des HCG gestiftet.
Ausschreibungstermin soll jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie sein, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturienten noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner/innen-Produkts soll am 22. April, Kants Geburtstag, erfolgen. Urkunden und Preise könnten dann zum Schuljahresende, für die Abiturienten auf der Abschlussfeier, überreicht werden.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt per Mehrheitsentscheidung durch die Philosophie-Lehrer und den Förderverein.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 8. HCO-Philo-Wettbewerb 2018/19:
Schreibe einen philosophischen Essay zum Thema: „Selbsterkenntnis“
Erläuterung: Gewünscht ist eine philosophische Reflexion zu den Fragen: Was ist Selbsterkenntnis? Wie unterscheidet sie sich von Selbstbewusstsein, Selbsterfahrung, Selbstbesinnung, Selbstkritik, Selbstgefühl, Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, Selbstverständnis, Selbstreflexion oder Selbstverwirklichung? Kann ich mich überhaupt selber erkennen, so wie ich einen Gegenstand oder eine andere Person erkennen kann? Und wenn ja, wie ist das möglich? Etwa, indem ich mir einen Spiegel vorhalte?
Zur Erinnerung: „Erkenne dich selbst!“ lautete die Forderung am Eingangsportal des Tempels zum antiken Orakel von Delphi. Seither haben Philosophen diese Forderung immer wieder an die Menschen gerichtet. Welche Bedeutung hat Selbsterkenntnis heute noch? Welchen theoretischen und/oder praktischen Wert besitzt sie für uns? Und mit welchen im weitesten Sinne philosophischen, psychologischen, neurowissenschaftlichen, sprachlichen, meditativen, psychoanalytischen oder sonstigen Mitteln kann sie realisiert werden? Dies alles sind nur Beispiele für Fragen, die hier passend gestellt werden könnten.
Was ist nun dein Konzept von Selbsterkenntnis? Du kannst frei und auch persönlich über die Frage nachdenken. Philosophisch wird dein Text dadurch, dass du Selbsterkenntnis in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektierst, sie z.B. unter ethischen, anthropologischen, erkenntnistheoretischen, sozialphilosophischen, wissenschaftstheoretischen oder sprachphilosophischen Gesichtspunkten beantwortest.
Dein Text soll maximal 4 computergeschriebene Seiten umfassen, Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangsstufe anzugeben; am Ende des Essays soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. (Unterschrift)
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für die eingesandten Texte sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisches (nicht fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität.
Und nun viel Spaß beim Schreiben eines Essays zum Thema „Selbsterkenntnis“!
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
8. HCG-Philo-Wettbewerb 2018/19
Ausschreibung: Am 15.11.2018, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (jeweils am 3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und alle 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Essays zum Thema „Selbsterkenntnis“.
Format: Computergeschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. (Unterschrift)
Einsendeschluss: Am 12.02.2019 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/in: Am 22.04.2019 (Kants Geburtstag und dieses Mal auch Ostermontag)
Preis: Bücher und Urkunden für die drei besten Texte.
PHILO Preis
HCG 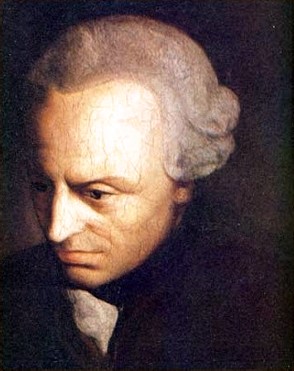 SOPHIE
SOPHIE
Herzlichen Glückwunsch!

22.04.2018: Königsberg meldet Entscheidung!
1. Preis: Berrin Yetiskin (2. Semester)
2. Preis: Hannah Vehse (2. Semester)
3. Preis: Sophia Brandt (2. Semester)
Philos und seine Freunde, allen voran Herr Rußbült und die Philosophie-Lehrer*innen des HCG, gratulieren ganz herzlich!
Die Preisverleihung wird am Mittwoch, den 04.07.2018, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, erfolgen. Die prämierten Texte sollen hier demnächst zusammen mit einem Foto veröffentlicht werden.
Ich bedanke mich vielmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gedankenreichen und anregenden Texte. Bis zur Ausschreibung des 8. HCO-Philo-Wettbewerbs am 15.11.2018, dem UNESCO-Welttag der Philosophie!
Dr. Ulrich Müller Berlin, den 22.04.2018
Berrin Yetiskin, 1. Preis:
Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?
Dass Kritik am deutschen Schulsystem geäußert wird, ist nichts Neues, denn immer
wieder werden in den Medien und auch generell in der Gesellschaft Mängel bezüglich
der Bildungssysteme zum Vorschein gebracht und diskutiert. Diese kritischen
Diskussionen lassen sich oft durch die Uneinigkeit bezüglich des föderalen Systems, die
unzureichende Vorbereitung auf das spätere Leben sowie aber auch durch die fehlenden
Möglichkeiten und Mittel zur Individualitätsentwicklung der Schüler kennzeichnen. Des
Letzteren wird zudem oft angemerkt, dass daher eine Förderung der Talente kaum
vorzufinden ist, stattdessen aber immer stärker die Abhängigkeit der Anerkennung von
guten Noten in den Vordergrund rückt. Daher ist die Frage, weshalb die Motivation der
Schüler von Jahr zu Jahr abnimmt auch recht überflüssig, da ein von Stress geprägter
Schulalltag, der im Endeffekt nur daraus besteht mit guten Noten zu überzeugen und
aufzufallen, nicht wirklich als etwas sehr ansprechendes von den meisten Schülern
wahrgenommen wird.
Interessant ist jedoch der Vergleich von Kindern, die kurz vor ihrer Einschulung stehen
sowie aber auch bereits die Grundschule besuchen, mit Jugendlichen während der
Mittel – und Oberstufe. Denn kleine Kinder haben eine viel größere Freude am Lernen,
wohingegen Jugendliche ihre Ferien und somit die Erlösung vom ganzen Stress kaum
noch abwarten können. Der Grund für diese Einstellung und im Endeffekt auch für
dieses Verhalten ist, dass kleine Kinder nicht allein nach erbrachten Leistungen bewertet
werden und der Konkurrenzkampf unter ihnen auch noch nicht so stark bis kaum
ausgeprägt ist. Sie werden viel öfter gelobt als ältere Schüler und die Anerkennung wird
bei ihnen nicht erzwungen sondern ergibt sich durch ihre Handlungsweisen sowie
Vorlieben.
Es ist natürlich in gewisser Weise auch vollkommen berechtigt, dass Oberstufenschüler
nicht wie Grundschulschüler bewertet werden, jedoch stellt dies nicht den Grund dafür
dar, sich nur auf die benoteten Leistungen eines Schülers zu beschränken, zudem diese
auch kaum etwas über den Charakter oder die Person selbst sowie über ihre
vorhandenen Kompetenzen aussagen. Denn dies führt nur zu einer gewissen
Oberflächlichkeit, aus dieser wiederum die Demotivation resultiert. Wenn zudem auch
bedacht werden sollte, dass die Jahre in der Oberstufe mit Abstand die wichtigsten sind
und genau hier eigentlich die meiste Motivation benötigt wird, fällt schnell auf, dass es
im Grunde viel an dem zurzeit vorhandenem Schulsystem zu verändern gäbe.
Denn der wesentliche Unterschied zwischen Grundschulen und Oberschulen ist, dass
ethische Werte in Grundschulen weitaus mehr gefördert werden, als in Oberschulen.
Dies bedeutet also, dass die Förderung von ethischen Werten verlangt sowie
durchgesetzt werden sollte um solch eine Verbesserung sowie Veränderung zu erreichen.
Denn somit würde den Schülern auch eine weitaus bessere Vorbereitung auf das spätere
Leben geboten werden, die von vielen Kritikern immer wieder gefordert wird.
Doch bevor ich konkrete ethische Werte, die meiner Meinung nach zukünftig einen
aktiven sowie großen Teil des Schulsystems darstellen sollten, nennen werde, möchte
ich zunächst den Begriff „Werte“ bezüglich der Ethik klären. Denn in der Ethik werden
Werte als Orientierungsmuster bezeichnet, die als eine allgemeine Zielorientierung
dienen sollen und von Menschen im unterschiedlichen Maße erstrebt oder auch
geschätzt werden. Ein weiterer Begriff, der bezüglich der Werte einen wichtige Rolle
spielt, ist „Norm“. Denn zwischen Normen und Werten besteht ein enger
Zusammenhang. Daher können Normen Werten beispielsweise als eine Art
Handlungsregel zugeordnet werden. Trotzdem sollte jedoch nicht vergessen werden,
dass sich beide Begriffe auf jeweils unterschiedlichen Ebenen befinden. Denn Normen
sind allgemeine Handlungsvorschriften und ermöglichen daher auch eine konkrete
Handlungsorientierung in bestimmten Situationen. Sie drücken aus, ob eine Handlung
geboten, erlaubt oder verboten ist und haben zudem auch noch die Funktion, die
allgemeinen Werte zu konkretisieren. Aus diesem Grund werden sie auch als Werte „in
kleiner Münze“ bezeichnet. Um den Zusammenhang zwischen Werten und Normen
genauer verdeutlichen zu können, möchte ich ein kleines Beispiel anführen und dies
anhand des Wertes „Gerechtigkeit“. Dieser Wert gibt das Ziel an, welches erreicht sowie
bereitgestellt werden soll und besitzt wiederum auch eine dazugehörige Norm, die
entsprechend zugeordnet werden kann. Die Norm gibt an auf was das Handeln
abgestimmt werden soll und würde in diesem Fall wie folgt lauten: „Handle und
verhalte dich gerecht!“.
Kulturen und ihre Leitbilder kommen zum größten Teil auch nur durch Werte zu Stande,
denn diese stellen ihr Gerüst und somit auch das einer Gemeinschaft dar, da sie für die
Sicherung des benötigten Zusammenhalts sorgen. Hier wiederum spiegelt sich auch ein
enger Zusammenhang zu Schulen und somit auch zur Bildung wieder, da diese ebenfalls
einer der wichtigsten Kulturgüter eines Landes darstellen und zudem auch das Mittel
zur Weiterleitung von Leitkulturen sind.
Schulen haben einen großen Einfluss auf die sich entwickelnde Sichtweise der nächsten
Generationen sowie auf deren gesellschaftliches Verhalten. Daher ist meine Frage nun,
wie zwei Bereiche unserer Gesellschaft, die mehrere Gemeinsamkeiten besitzen und
zudem auch noch beide jeweils eine große Bedeutung aufweisen, doch so abgespalten
und getrennt voneinander gestaltet werden können.
Bevor ich jedoch diese Frage beantworte, komme ich zunächst einmal wieder auf die
Ausgangsfrage, welche ethischen Werte denn nun von Schulen gefördert werden sollten,
zurück. Hierfür habe ich mich auf die meiner Meinung nach sechs wichtigsten Werte
beschränkt und werde diese nun vorstellen. Beginnen würde ich gerne mit dem Wert
Gerechtigkeit, der in dem obigen Beispiel bereits angeführt wurde. Sich gegenüber
seinen Mitschülern gerecht zu verhalten ist eigentlich so gut wie selbstverständlich,
doch diese Selbstverständlichkeit wird im Schulalltag des öfteren auf die Probe gestellt.
Denn wer kennt sie nicht, die Geschichten über Mobbing in der Schule und die
Mitläufer, die sich aufgrund des Gruppenzwangs bei der ganzen Sache beteiligt haben.
Schüler, die sich in solchen Situationen jedoch immer die Gerechtigkeit als Ziel setzen
und sich dementsprechend auch verhalten, sollten daher gefördert sowie deutlich stärker
anerkannt werden. Denn sich gegen eine Gruppe, die zudem auch meistens noch den
eigenen Freundeskreis darstellt, zu positionieren und sich somit in der entsprechenden
Situation ethisch korrekt zu verhalten, ist schwer und erfordert sehr viel Mut sowie
Überwindung. Doch es sagt auch viel über die Person selbst aus und ist, meiner
Meinung nach viel wertvoller für das spätere Leben als beispielsweise manch andere
Dinge, die einem in der Schule beigebracht werden. Denn ein auf Gerechtigkeit
ausgerichtetes Handeln sichert auch den Zusammenhalt einer Gesellschaft in schweren
Zeiten, in schweren Zeiten die bereits jetzt schon zu erkennen sind und von
Rechtspopulismus und der Bildung von immer größer werdendem Hass geprägt werden,
gemeint sind damit also gesellschaftliche Konflikte. Die nächsten Generationen sollten
auf diese vorbereitet werden und gerechtes und ungerechtes Handeln ohne Probleme
voneinander unterscheiden können, sodass sie die Garantie für die Weiterleitung einer
auf Gerechtigkeit abgestimmten Leitkultur bilden.
Ein weiterer ethischer Wert der meiner Meinung nach von Schulen gefördert werden
sollte, ist die Verantwortung. Ein verantwortungsbewusstes Verhalten ist genauso wie
das stets auf Gerechtigkeit abgestimmte Verhalten nicht immer selbstverständlich. Doch
sich seiner eigenen Verantwortung bewusst zu sein und zu werden ist mehr als wichtig.
Dies gilt nicht nur für den Schulalltag, in dem beispielsweise eine produktive
Ergebnissicherung auch größtenteils nur von einer verantwortungsbewussten
Arbeitsphase abhängig ist, sondern auch für das spätere Leben in einer Gesellschaft.
Denn die Menschheit befindet sich gerade in einem mehr oder weniger aufgeklärten
Zeitalter. Es kann jedoch mit Sicherheit noch nicht von einer endgültig aufgeklärten
Gesellschaft gesprochen werden, da sich die meisten Menschen der Verantwortung
bezüglich ihrer Äußerungen in der Öffentlichkeit, beispielsweise zu politischen
Themen, sowie aber auch bezüglich ihrer Entscheidungen, die unter anderem auch die
Öffentlichkeit betreffen, wie beispielsweise die Bundestagswahlen in Deutschland, nicht
bewusst sind und diese nicht ernst genug nehmen. Hierbei spielt Kant wiederum auch
eine entscheidende Rolle, da er derjenige war, der die Aufklärung definierte und auch
verdeutlichte, dass diese, wie sie von ihm beschrieben wurde, nur möglich ist, wenn
sich jede Person der Verantwortung seines Handelns und der Verantwortung der
öffentlichen Rede bewusst ist. Um genau dies zu ermöglichen, sollte das
Verantwortungsbewusstsein der Schüler auch in der Schule gefördert werden, sodass
erstens eine erweiterte Denkungsart, welche auch von Kant erstrebt wurde, erreicht
wird und damit zweitens am Ende auch von einer richtigen Aufklärung gesprochen
werden kann.
Die Kreativität ist ein weiterer ethischer Wert, der meiner Meinung nach auch von
Schulen gefördert werden sollte und zudem auch noch viele wichtige Grundsteine für
die Individualitätsentwicklung eines Schülers bietet. Denn eine Förderung der
Kreativität bedeutet zugleich auch eine Förderung der Vielfalt in den kommenden
Generationen, welches wiederum einer der wichtigsten Voraussetzungen für die
Weiterentwicklung einer Gesellschaft ist. Zudem wird dadurch auch der Schulalltag viel
bunter gestaltet und für die Schüler ansprechender, da sie dann die Möglichkeit erhalten
ihre Ideen aktiv umzusetzen. Es wird somit also auch für Vielfalt in Schulen gesorgt.
Doch Vielfalt funktioniert nur, wenn auch Toleranz vorhanden ist.
Daher ist Toleranz der nächste ethische Wert der meiner meiner Meinung nach ebenfalls
von Schulen gefördert werden sollte. Denn ein tolerantes Verhalten untereinander lässt
die Vielfalt in einer Gesellschaft und somit auch im einfachen Alltag erst zu. Ein
Schulalltag beispielsweise ohne Toleranz würde auch nicht richtig funktionieren, da
jeder Schüler dazu verpflichtet ist seine Mitschüler zu akzeptieren und zu respektieren,
unabhängig von Kultur, Religion und Hautfarbe. Diese Handlungsorientierung ist für
die Zukunft der Schüler von großer Bedeutung und legt die Grundsteine für den
Zusammenhalt einer Gesellschaft. Es prägt ihre Sichtweise auf verschiedene
Menschengruppen, welche aber auch sehr leicht zu manipulieren ist, wie leicht genau,
beweisen die Reden der Rechtspopulisten, die leider immer wieder großen Zuspruch
von Bürgern erhalten. Eine Förderung von Toleranz beispielsweise, soll unter anderem
diesen Zuspruch senken und die Gesellschaft auf den Umgang mit solchen Gefahren,
wie die des Rechtspopulismus‘, vorbereiten.
Ein weiterer Wert, dem eine Förderung der Schulen zugesprochen werden sollte, ist das
Interesse aus dem dann im Endeffekt das Engagement folgt. Es ist wichtig das Interesse
von Schülern anzuerkennen und diesem entgegenzukommen. Das Zeigen von Interesse
sollte einen viel höheren Stellenwert bei der Benotung der Schüler einnehmen, da sie
dadurch auch zum Mitmachen und Lernen ermutigt sowie motiviert werden.
Doch sie bekommen dadurch auch die Möglichkeit ihre eigenen Interessen zum
Vorschein zu bringen und diese auch umzusetzen sowie kreativ auszuleben, was
wiederum eine Verknüpfung von zwei Werten ermöglicht. Zudem werden Schüler
dadurch auch viel weltoffener, da sie lernen sich für neue Dinge zu begeistern und sich
auf diese auch einzulassen. Eine weltoffene nächste Generation ist für mich nur das
einzig vorstellbare, denn eingeschränktes Denken sowie fehlende Begeisterung führt
nur zum Rückgang einer Gesellschaft.
Der letzte hier genannte Wert, der meiner Meinung nach auch unbedingt von Schulen
gefördert werden sollte und unabdingbar ist, ist die Freiheit, welche besagt, dass die
eigenen Rechte von Nichts und Niemandem eingeschränkt werden sollten. Den
Schülern dies stets zu übermitteln und ihnen zu ermöglichen zu jeder Zeit zu ihren
Rechten zu stehen und diese auch zu kennen, ist einer der wichtigsten Aufgaben der
Schulen. Denn sind sich die Schüler ihren Rechten bewusst, wird auch ihr
Selbstbewusstsein gestärkt. Dadurch wird eine aufgeklärte nächste Generation auch
bereits mehr oder weniger sichergestellt, da Schülern nun verdeutlicht wird, dass sie
nicht alles was Ihnen gesagt wird, glauben müssen und sollen und ein Recht auf
Hinterfragung haben.
Nun stellt sich also die Frage wieso all diese ethischen Werte zwar mehr oder weniger
bereits an Schulen dieser Welt vorzufinden sind aber in unterschiedlichem Maße
gefördert werden. Die unterschiedliche Förderung liegt daran, dass Werte von
Menschen in unterschiedlichem Maße geschätzt sowie erstrebt werden und sich somit je
nach Menschen – oder besser gesagt Gesellschaftsgruppen an die jeweiligen
Bildungssysteme anpassen. Da diese verschiedenen Gesellschaften aber auch immer
einer Führung unterstehen, könnte genauso gut auch gesagt werden, dass sich die
Miteinbindung und somit auch Förderung von ethischen Werten in Schulen in vielen
Fällen auch durch die Abhängigkeit der Interessen des Staates kennzeichnen lassen.
Das bedeutet also das viele Regierungen, welche meistens auf kein demokratisches
System zurückzuführen sind, die Förderung von ethischen Werten in ihren Schulen stark
an ihre Sichtweise und kulturelle Überzeugung anpassen und sich somit ihre
Machterhaltung sichern. Denn eine weltoffene und sich ihren Rechten stets bewusste
Gesellschaft ist schwieriger zu kontrollieren und bringt auch deutlich mehr Gefahren
mit sich als eine sich kaum widersetzende und wehrende Gesellschaft, weswegen auch
immer wieder eine Trennung von ethischen Werten und Bildung vorzufinden ist.
Diese Denkweise ist natürlich ziemlich breit gefasst und bezieht sich nicht mehr nur auf
Deutschland. Denn wenn nun wieder auf deutsche Schulen und auf die deutsche
Regierung geblickt werden sollte, die wiederum auf ein demokratisches System
zurückzuführen ist, kann abschließend gesagt werden, dass durch eine Förderung von
den oben genannten Werten, Gerechtigkeit, Verantwortung, Kreativität/Vielfalt,
Toleranz, Interesse sowie Freiheit nicht nur die Individualitätsentwicklung der Schüler
begünstigt sowie erst ermöglicht wird, sondern der Schulalltag dadurch auch generell
um einiges bunter gestaltet wird und somit auch die älteren Schüler wieder zum Lernen
motiviert werden. Zudem kann somit auch in Zukunft der Zusammenhalt der
Gesellschaft sichergestellt werden, da gesellschaftliche Konflikte nicht mehr für all zu
große Hindernisse sowie Probleme sorgen würden.
Zusammenfassend kann ich also sagen, dass eine Förderung dieser Werte nicht nur zu
einer Verbesserung des Schullebens führen würde sondern auch das spätere Leben der
Schüler positiv beeinflussen würde, da dadurch die Erhaltung einer friedlichen sowie
einer nach Kant richtig aufgeklärten Gesellschaft sichergestellt wäre.

Hannah Vehse, 2. Preis:
Welche ethischen Werte sollten in einer Schule gefördert werden?
Als mein Bruder von seinem ersten Schultag nach Hause kam, bat ich ihn, mit mir Schule zu spielen. Er sollte mir zeigen, was er erlebt hatte, wie der Unterricht aussah. Er sagte nein, er wollte nicht. Ich bat ihn nochmal und nochmal, bis er schließlich zustimmte. Ich hatte eine große Tafel in meinem Zimmer und ein Stück Kreide, das er nahm und damit eine Zahl an die Tafel schrieb und mir erklärte. Ich war fasziniert und wusste sofort, ich wollte Lehrerin werden. Und das möchte ich noch immer.
Wenn ich daran denke, wie mein späteres Leben aussehen wird, dann sehe ich mich vor einer Klasse stehend, und die Schüler sehen mich an und ich schreibe etwas an die Tafel, wie Jannis es getan hatte, und die Sonne scheint in den Raum und erfüllt ihn mit einer zauberhaften Stimmung, in der man sich ganz leicht fühlt und in der alles geht. In meiner Vorstellung bin ich natürlich die tollste Lehrerin der Welt, und wenn ich die Schule mal verlassen sollte, dann laufen die Schüler mir nach, wie in einem Film, den ich als kleines Mädchen mal gesehen habe. Und doch ist mir klar, dass es so niemals sein wird, dass die Sonne nur an wenigen Tagen so scheint, und dass nicht alle Schüler begeistert bei mir sein werden. Einige vielleicht sogar die meisten, werden aus dem Fenster sehen oder sich gegenseitig an, und vielleicht gar nicht auf das achten, was ich gerade mache.
Ich weiß, dass es so sein kann, aber ich will es mir nicht vorstellen, weil der Traum dann einfach kein Traum mehr wäre. Und vielleicht könnte ich es ja schaffen, die Schüler so zu verzaubern, wie die Sonne mich verzaubern soll. Aber wie? Ich müsste sie packen, müsste sie entflammen und das banalste Thema zu einem machen, von dem sie immer mehr erfahren wollen. Ich hätte da auch schon ein paar Ideen. Aber ich vergesse dabei, dass es in der Schule nicht nur um Wissen geht. Es geht auch nicht nur darum, eine schöne Zeit zu verbringen, aus der man nichts als Freunde mitnimmt. Es geht darum, aus kleinen Menschen große zu machen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich dachte, bevor ich in die Schule kam. Wenn ich mich in einer Situation befinde, ganz gleich in welcher, dann wüsste ich nicht, wie ich mich mit vier Jahren entschieden hätte. Die Schule hat mich zu einem Menschen gemacht, der Dinge miteinander verknüpft und zweimal überlegt. Und das, obwohl sie mir nie gesagt hat, dass ich zweimal überlegen soll. Sie hat mir Werte mitgegeben, auf die ich nicht verzichten möchte. Und welche, auf die ich gut verzichten kann. Doch welche Werte möchte ich den Menschen mitgeben, die als kleine Menschen vor mir sitzen werden und durch mich ein kleine bisschen größer werden sollen? Welche Werte kann ich ihnen mit gutem Gewissen überreichen, und welche Werte müssen überreicht werden, um ihnen die Größe zu geben, die sie mal haben sollen, auch wenn ich nicht die sein möchte, die sie ihnen überreicht? Bei welchen Werten wird es überhaupt an mir liegen, sie zu überreichen? Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?
In meiner Grundschule hatte ich eine Lehrerin namens Frau Vierhaus. Sie unterrichtete den typischen Grundschul-Religionsunterricht, in dem man Ausmalbilder von biblischen Szenen ausmalt und an seinem Pausenbrot knabbert, während die Lehrerin die zu den Bildern passenden Geschichten vorliest. Natürlich liebte jeder diesen Unterricht – die meisten waren sich nicht einmal sicher, ob man ihn Unterricht nennen könnte. Ich aber liebte den Unterricht, weil ich Frau Vierhaus liebte, diese Frau, die so unsagbar nett und einfach ein guter Mensch war. Und auch wenn ich aus dem vierjährigen Religionsunterricht nur den Text des Vater Unsers und die Namen von Jesus´ Eltern mitgenommen habe, so hat mir diese Lehrerin doch viel mehr mitgegeben: Ich weiß noch, wie wir in den siebten Stunden (ein unverschämt langer Schultag für damalige Verhältnisse) mit Frau Vierhaus dasaßen und müde waren und Frau Vierhaus lächelte uns einfach an und meinte: „Ich weiß, dass ihr einen langen Tag hinter euch habt. Wenn ihr wollt, machen wir jetzt keinen Unterricht mehr.“ Stattdessen hatte sie uns Kekse und Äpfel mitgebracht, die wir alle essen und dabei einfach nur reden durften. Dabei war ihr wichtig, dass alle Stücke Apfel gleich groß waren, dass wir nicht vordrängelten, um an sie zu kommen, und dass wir beim Essen nicht rumtobten und laut waren, da in anderen Räumen noch Unterricht stattfand. Das waren die allerschönsten Stunden, in denen wir keinen Unterricht machten, und doch mehr lernten, als in allen anderen Stunden zusammen. Denn wir lernten etwas fürs Leben. Wir lernten, moralisch zu handeln.
Im Nachhinein ist mir klar, dass ich solche Werte von anderen Lehrern wahrscheinlich nicht so protestlos angenommen hätte. Man nimmt Werte nämlich eher von Personen an, zu denen man eine Bindung hat, sei´s nur, weil man sie sympathisch findet, da man ihnen mehr Vertrauen entgegenbringt als anderen. Bei Menschen hingegen, von denen ich weiß, dass ihre Ansichten nicht mit meinen übereinstimmen, ist man skeptischer, und wenn man sie vielleicht sogar nicht mag, kann es sein, dass man sich aus Überzeugung weigert, deren Werte zu übernehmen, auch wenn sie wohlmöglich vernünftig klingen. Die Lehrer sollten ihren Schülern also ein Vorbild sein und keine reine Autoritätsperson. Nur dann können auch erfolgreich Werte vermittelt werden.
Aber welche? In der Schule lernen die Kinder, ordentlich zu sein und gehorsam, hübsch zu schreiben, malen, singen und sprechen. Und natürlich ist es wichtig als Erwachsener, zu wissen wie man sich sortiert und ein förmliches Schreiben auch förmlich formulieren kann. Dennoch sind Kinder, diese kleinen, unverbogenen und formbaren Menschen, die meiste Zeit des Tages in der Schule, Zeit, in der sie zu dem geformt werden, was sie später mal sein werden. Da ist es auch wichtig, dass die Schule das Vermitteln von Werten unterstützt, deren Vermittlung eigentlich Aufgabe der Eltern ist, sonst ist es, wie Reinhard Mey schrieb: „Die Schule mach sich kleine graue Kinder, blass und brav.“
Um dies zu verhindern gibt es zwei meiner Meinung nach ganz entscheidende und wahre Werte, die jeder Mensch besitzen sollte, da sie ihn zu einem besseren machen: Menschlichkeit und Mut. Dabei geht es nicht um Mut, wie er bei Mutproben abgefragt werden kann, sondern um Mut, für die richtige Sache aufzustehen, sich für andere einzusetzen, und nicht immer nur das zu tun, was die Lehrer sagen, sondern den Mut zu haben, selbst mitzudenken. Das einzige Problem dabei ist, dass ein Lehrer dem Schüler schlecht sagen kann, dass der Schüler nicht alles hinnehmen soll, was der Lehrer sagt, da dieser sonst in seiner Lehrerfunktion sinnlos ist. Aber ich finde es notwendig, dass die Kinder diesen Mut besitzen lernen und auch nicht davor zurückschrecken, ihn zu nutzen, weil sie sich vor Strafen oder einer Verschlechterung der Note fürchten. Es muss Aufgabe der Lehrer sein, Hinterfragungen nicht zu verurteilen, sondern zu unterstützen und zu loben. Generell sollte man an Loben zur rechten Zeit nie sparen, da die Macht eines Lobes oder Kompliments riesig ist und Menschen eine Zeit lang davor bewahrt, der aus den Mengen des Lernstoffs entstehenden Resignation zu verfallen, und sie so für das Empfangen neuer Werte öffnet. Wie Menschlichkeit.
Müsste es nicht die Eigenschaft jedes Menschen sein, menschlich zu sein? Und doch sind einige Menschen, die die Schule verlassen, nicht gerade menschlich zueinander, wenn sie sich gegenseitig bestehlen oder verletzen. Doch was ist Menschlichkeit überhaupt?
Menschlichkeit bedeutet, rational zu denken und alle Motive gegeneinander abzuwägen, gleichzeitig bedeutet es, auf Gefühle einzugehen und auch mal aus dem Bauch heraus zu entscheiden, ein Herz zu haben. Es bedeutet, moralisch zu handeln. Es bedeutet, im Religionsunterricht die Kekse unter allen gerecht aufzuteilen.
Und zwar egal, mit wem man teilen soll. Egal, woher derjenige kommt und egal, welche Ansichten er hat. Dies ist ein weiterer, ganz entscheidender Wert, der ebenso wichtig wie Menschlichkeit und Mut ist: Toleranz. Denn ohne Toleranz wäre das Leben ein einziger Krieg und die ganze Welt das Schlachtfeld. Ohne Toleranz wären wir Irre, die zwar Gefühle und Rationalität besitzen, jedoch diese nicht zu nutzen vermögen würden. Aus diesem Grund muss jedem Menschen, egal wie alt, immer wieder beigebracht werden, dass jeder Mensch seine Würde und somit seinen Wert an sich selbst besitzt, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, ganz gleich seiner Hautfarbe oder Religion.
Es gibt verschiedene Strategien, gerade kleinen Kindern im Grundschulalter dies verständlich zu machen. So wäre es möglich, dass beispielsweise die Toleranz gegenüber allen Religionen vermittelt wird, indem die Lehrer sie auch in der Schule ausleben und den Schülern so zeigen, dass jede Religion ihre Daseinsberechtigung im „normalen Leben“ hat und niemals eine verachtet werden sollte. Auf diese Weise könnten die Kinder auch etwas über die Religionen lernen. Die Vergangenheit hat jedoch bewiesen, dass es so nicht funktioniert. Kleine Kinder haben einen Lieblingslehrer, zu dem sie einen stärkeren Bezug haben als zu anderen, ebenso wie sie Eltern haben, von denen sie sich leicht beeinflussen lassen. All diesen Personen vertrauen sie mehr als Lehrern, die sie nicht mögen.
Angenommen also, die Eltern eines Kindes wären Atheisten und würden privat über Christen schimpfen, dann wäre es für das Kind unmöglich, Toleranz zu lernen, wo doch der verhasste Mathelehrer zufälligerweise noch ein überzeugten Katholik ist, welcher nur mit seinem Kreuz um den Hals und der Bibel in der Hand in der Schule auftaucht.
Andererseits könnte ein Schüler, dessen Lieblingslehrer orthodoxer Jude ist und dies auch öffentlich bekundet, nicht mehr objektiv an die Beurteilung der Religionen herangehen. Er wäre voreingenommen. Das Gegenteil von tolerant.
Aber auch für den Lehrer ist die andere Möglichkeit, Toleranz zu vermitteln, geeigneter, denn wie soll es ihm möglich sein, zu unterrichten, wenn die von ihren Eltern beeinflussten Kinder ihn wegen seines Glaubens beschimpfen sollten? Diese andere Möglichkeit ist die momentan geltende, nämlich das Verbot für Lehrer, vor der Klasse ihre eigene Meinung kundzutun oder ein Kopftuch zu tragen. Man könnte zwar dagegen argumentieren, dass so das recht der freien Meinungsäußerung und die Religionsfreiheit missachtet werden. Jedoch sind meiner Meinung nach das berufliche und private Leben voneinander zu trennen, wenn es darum geht, der Zukunft des Landes und der Welt eine objektive Beurteilungsgrundlage zu bieten.
Die Frage ist nur: Wo sind die Grenzen? Ist ein kleines, goldenes Kreuz aus Metall an einer Halskette vielleicht schon zu viel, oder ist es erst das Kopftuch oder die Kippa? Und man kann noch weiter denken: Wann ist jemand nur ein Mensch mit anderen Ansichten, die es zu respektieren oder zumindest tolerieren gilt, und wann ein gefährlicher Verrückter? Es gibt eine Grenze, es muss sie geben, jedoch ist sie schwammig und nicht einsichtbar und ändert sich mit der Zeit.
Hingegen wird sich niemals ändern, dass ein weiterer Wert unbedingt vermittelt werden muss: Respekt. Dieses geht Hand in Hand mit der Menschlichkeit. Ohne diese Werte wären wir Menschen nicht imstande, in einer intakten Gesellschaft zu leben. Wir wären Inseln oder Eisberge, die andere Schiffe rammen und zum Untergehen bringen oder in der Hitze irgendwann schmelzen und mit unserem Wasser andere Inseln überschwemmen. Wir wären nicht mehr menschlich.
Deshalb ist es die Pflicht eines jeden, immer und überall Werte zu vermitteln, und die Welt so hoffentlich zu einem besseren Ort zu machen, egal, wer er ist. Auch wenn man dies nicht tut, so handelt man doch immer nach bestimmten Werten, und allein das ist eine Botschaft. Man muss dann selbst entscheiden, welche Botschaften man annimmt. Das ist es, was die Schule insbesondere fördern sollte und womit man nie, nie aufhören darf: Nachdenken. Dann wird uns ganz von allein klar, dass es tatsächlich so ist, wie Reinhard Mey sagt: „In dieser Welt gehen die wahren Werte uns abhanden.“ Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir es ändern.
Wenn ich daran denke, wie mein späteres Leben aussehen wird, dann sehe ich mich vor einer Klasse stehend, und die Schüler sehen mich an und ich schreibe etwas an die Tafel, wie Jannis es getan hatte, und die Sonne scheint in den Raum und erfüllt ihn mit einer zauberhaften Stimmung, in der man sich ganz leicht fühlt und in der alles geht. Und nun weiß ich auch, was ich an die Tafel schreiben werde. Ich werde versuchen, dies kleinen Menschen in den Arm zu nehmen und nicht auf Abstand zu halten. Ich werde mit ihnen lachen und mit ihnen Kekse teilen. Ich werde alles tun, um dafür zu sorgen, dass ihr Wissensdurst nicht unter Bevormundung und Zwang versiegt. Ich werde alles tun, um sie zu verzaubern und aus kleinen Menschen menschliche kleine Menschen zu machen. Denn wenn es der Welt, diesem verrückten Ort, gerade an etwas wirklich fehlt, dann ist es Menschlichkeit. Davon bin ich überzeugt.
Quellen:
Beide Reinhard Mey-Zitate stammen aus seinem wunderschönen und wahren Lied „Faust in der Hand“.

Sophia Brandt, 3. Preis:
Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?
Da diese Frage vor allem auf die Vermittlung, Förderung und Umsetzung ethischer Werte in der Schule abzielt, möchte ich mich zunächst mit der Institution Schule befassen.
Die Schule ist in erster Linie eine Bildungs- oder Lehranstalt, eine Institution mit dem Auftrag „Wissen und Können durch Lehrer an Schüler“1 zu vermitteln. Doch durch den gesellschaftlichen Wandel muss die Schule heute noch andere Aufgaben übernehmen. Da heutzutage in den meisten Haushalten beide Elternteile vollzeitlich berufstätig sind, verbringen viele Kinder fast den gesamten Wochentag in der Schule bzw. jüngere Kinder danach im Hort oder in einer Betreuung, ältere Kinder nach der Schule alleine zuhause. Somit muss die Schule einen Teil der Erziehung und Vermittlung wichtiger ethischer Grundwerte übernehmen. Zusätzlich nimmt die Nachfrage nach allgemeinen gesellschaftlichen Normen und damit einem angenehmen Zusammenleben zu, während der Drang nach Selbstentfaltung ebenfalls wächst. Außerdem muss in den Schulen aufgrund der Globalisierung und aktueller Ereignisse Offenheit gegenüber anderen Kulturen oder Lebensweisen gefördert werden. Des Weiteren soll die Schule auf das Berufsleben angemessen vorbereiten und so den Kindern einen guten Einstieg ins spätere Leben bieten.2
Es werden also immer größere Anforderungen an die Schule gestellt, ihre Aufgaben nehmen an Menge und Bedeutung zu. Doch wie kann eine Schule diese Wertevorstellungen und gesellschaftliche Normen nachhaltig vermitteln? Was sind überhaupt Werte und kann man sich auf allgemeingültige Werte festlegen?
„Wertesysteme.de“ definiert Werte folgendermaßen: „…Wertevorstellungen (Werte) sind erstrebenswerte und subjektiv moralisch als gut befundende Eigenschaften, Qualitäten oder Glaubenssätze.“3 Diese resultieren aus festgelegten Normen und erzeugen so „Denkmuster, Handlungsmuster und Charaktereigenschaften sowie Ergebnisse mit gewünschten Eigenschaften.“3
Werte sind also etwas als gut Angesehenes, das unser Handeln bestimmt. Es gibt viele verschiedene Werte, die subjektiv hinsichtlich ihrer Wichtigkeit und Bedeutung eingeschätzt werden und in Beziehung zueinander stehen.
Da Deutschland zu den christlich und von der Aufklärung geprägten Abendländern gehört, erscheint es mir logisch, in diesen Philosophien nach universellen Grundwerten zu suchen. Für mich ist dabei eine der Hauptlehren des Christentums am wichtigsten: die Nächstenliebe oder zumindest (als „abgeschwächte“ Form) gegenseitiger Respekt. Gegenseitiger Respekt erst macht ein angenehmes und sicheres Zusammenleben möglich, dieser ist außerdem in der „Goldenen Regel“ der Ethik festgehalten („Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.“4). Diese Regel ist in ähnlicher Form auch im Judentum, Hinduismus, Buddhismus, anderen Religionen sowie der griechisch-römischen Antike zu finden.4 Respekt ruft Vertrauen, Wertschätzung, Toleranz, Kompromissfähigkeit, Ehrlichkeit und Gewaltlosigkeit hervor – Werte, die ich als essentiell für eine funktionierende Gemeinschaft erachte. Viele Werte, die den Umgang betreffen, sind im Grundgesetz verankert und gewähren den Menschen Gleichheit, Sicherheit und Freiheit des Einzelnen. Dass diese Werte in Deutschland grundgesetzlich festgelegt sind, zeigt ihre Wichtigkeit auf und damit die Notwendigkeit, sie den Kindern nahezubringen. Aus eigener Erfahrung kenne ich Möglichkeiten, diese Werte zu vermitteln.
Beispielsweise hängen in manchen Klassenräumen von der Klasse selbst erarbeitete und verfasste Plakate zum Umgang miteinander. Diese beinhalten Sätze mit wichtigen Wertevorstellungen wie „Wir lassen einander ausreden“ oder „Wir schließen keinen aus“, und schaffen dadurch gegenseitigen Respekt und eine angenehme Atmosphäre in der Klasse. Durch die Aktion der Klasse, sich diese Sätze selber zu erarbeiten, wird ein besseres Verständnis für diese Werte geschaffen, welche außerdem den Grundstein für ein gutes, höfliches Benehmen bilden, das nicht nur im späteren Berufsleben, sondern auch im Familienleben, in Beziehungen oder Ähnlichem erwartet wird. Auch der Ethikunterricht ist dafür sehr förderlich, wenn zum Beispiel über „Gutes Handeln“ oder „Verantwortung“ gelehrt und sich ausgetauscht wird.
Dies bringt mich zu einem weiteren wichtigen Wert: dem verantwortungsvollen Umgang sowohl miteinander als auch mit eigenen oder anvertrauten Gütern. Dieser Wert geht mit Respekt einher, ist jedoch für das Leben und das Berufsleben nicht weniger wichtig, da nur so eine gute Arbeitskultur gewährleistet werden kann. Werte wie Fleiß, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt und Genauigkeit sind essentiell für das Berufsleben, deshalb sollten auch diese in der Schule vermittelt werden.
Die genannten Werte oder auch Tugenden dienen sowohl zur Erziehung und Förderung der Schüler als auch zur Sicherheit der Schüler und sind größtenteils in einer Schulordnung festgelegt.
Am Hans-Carossa-Gymnasium sind beispielsweise Regeln für Ordnung und Sauberkeit, Sicherheit der Schüler vor “externen“ Gefahren (z.B. einem Feuerausbruch) und „internen“ Gefahren (z.B. durch andere Schüler) festgelegt. 5
Auch andere Werte, die vielleicht nicht von besonderer Bedeutung im Berufsleben sind, dafür aber von Bedeutung für das allgemeine Leben, sollten in der Schule vermittelt werden. Ich denke hierbei zum Beispiel an Solidarität, ein Gemeinschaftsgefühl, Hilfsbereitschaft, Fairness, Authenzität.
Auch Werte, die Beziehungen betreffen, wie Ehrlichkeit, Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauen, etc. gehören dazu. Diese durch Gesetze oder Regeln festzulegen, ist schwierig, da die Überprüfung dieser Regeln meist nicht möglich ist, und diese Werte eher aus freien Stücken angenommen werden sollten. Trotzdem könnte der Ethik- oder Philosophie-Unterricht dafür genutzt werden, ein Bewusstsein für diese Werte zu schaffen und durch Diskussion und Austausch mit anderen Schülern seinen Horizont zu erweitern und seine Meinung in positivem Sinn zu formen.
Wertevermittlung geschieht jedoch nicht nur im Religions-, Ethik- oder Philosophie-Unterricht. Werte und Normen können auch in anderen Unterrichtsfächern behandelt werden, indem die werthaltigen Aspekte eines Themas oder Textes stärker in den Mittelpunkt des Unterrichts gerückt werden. Dabei sollte es sich jedoch nicht um belehrende „moralisierende“ Texte handeln, die von Schülern meist abgelehnt oder abgewehrt werden. Stattdessen sollten die Schüler selbst die Möglichkeit zu sachbezogener Reflexion, Konfrontation und eigener Erkenntnisgewinnung und Meinungsbildung bekommen. Im Deutschunterricht kann das beispielsweise durch Analysieren oder Interpretieren literarischer Texte erreicht werden. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Lehrer ein gutes Vorbild für ihre Schüler darstellen, sich fachlich und didaktisch mit dem Stoff auseinander setzen, sachliche Fakten und persönliche Meinungen auseinander halten, sich authentisch verhalten und offen sind für neue Meinungen oder andere Ideen.
Der Unterricht und ein gutes Vorbild des Lehrers können den Schülern jedoch nicht aufgezwungen werden. Aus diesem Grund helfen eine Schulordnung und festgelegte Grundregeln als verbindliche Erwartungen. Diese können, wie schon oben beschrieben, zum Beispiel selbst erarbeitete Umgangsformen auf einem Plakat an der Wand sein. Hier werden immer noch Werte vermittelt, allerdings handelt es sich hierbei um verbindliche Regeln, die eingehalten werden müssen. Auch wenn dadurch keine freie Annahme der Werte gewährleistet wird, ist es manchmal trotzdem notwendig, Regeln festzulegen, die für das schulische Leben unentbehrlich sind.
Diese Regeln sollten jedoch durch Gründe legitimiert werden, damit die institutionellen Normen einer Schule für alle einleuchtend sind. Beispielsweise müssen alle leise sein, wenn einer redet, damit man ihn verstehen kann. Damit alle sich sicher fühlen können, darf keiner Waffen oder Messer in die Schule mitbringen. Handys und Essen im Unterricht sind verboten, da sie die Konzentration ablenken und eine produktive Arbeitsatmosphäre verhindern.
Damit diese Werteerziehung in der Schule auch funktioniert, muss die Schule jedoch auch die nötige Autorität besitzen und diese Regeln durchsetzen, um Lehrer und Schüler zu schützen und zu fördern.
Eine weitere Ebene der Wertevermittlung ist eine Schulkultur. Durch Arbeitsgemeinschaften, gemeinschaftliche Aktivitäten, Feste, künstlerische Gestaltung der Schule und Exkursionen oder auch Philosophie-Wettbewerbe lernen die Schüler diese wichtigen Werte kennen und schätzen. Sie gestalten gemeinsam nicht nur die Schule, sondern machen auch grundlegende Erfahrungen, durch die sich ihre Wertevorstellungen bilden, die ihr ganzes Leben lang halten. Zudem erlernen sie neben den Werten noch weitere wichtige soziale Kompetenzen und Teamfähigkeiten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, die Schule – nicht mehr nur als Institution für Bildung, sondern auch für Wertevermittlung und Erziehung – sollte Werte weitergeben, die wichtig für ein angenehmes gemeinschaftliches Leben sind (wie zum Beispiel Respekt, Vertrauen, Toleranz, Kompromissfähigkeit, Ehrlichkeit), aber auch Werte, die besonders im späteren Berufsleben gesucht und erwartet werden (wie zum Beispiel Fleiß, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Hilfsbereitschaft). Andere Werte (wie zum Beispiel Solidarität, Gemeinschaftsgefühl, Fairness) können nicht in direkt im Unterricht gelehrt werden, sondern müssen im Schulleben von den Schülern selber erlebt und erfahren werden.
Quellen:
1: https://de.m.wikipedia.org/wiki/schule
3: https://www.wertesysteme.de/was-sind-werte/
4: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Goldene_Regel
5: https://hcg-berlin.de/schule/unsere-regeln-1/schulordnung
https://www.hermann-giesecke.de/schulwer.html
PHILOSOPHIE-PREIS 2012-2018:
hische Beantwortung der Frage:
„Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?“
Der Werte-Baum der Anna-Siemsen-Schule Hannover
Liebe Schülerinnen und Schüler,
der am 17.11.2011 erstmalig ausgeschriebene „HCO-Philo“-Wettbewerb möchte Themen, Reflexionsformen und Produktarten fördern, die im Lehrplan des Philosophie-Unterrichts nicht oder selten vorkommen, dennoch von philosophischer Bedeutung Analyse, Interpretation und Erörterung sein, sondern freiere Formen, etwa Kritik, Kommentar, Essay, Entgegnung, Dialog, Meditation, Brief, E-Mail, Blog, Gutachten, Bildreflexion etc.; Thema und Produktart werden jährlich geändert.
In jedem Fall aber soll die euch gestellte Aufgabe mit den Mitteln philosophischer Reflexion bearbeitet werden. Darin liegt ein direkter Unterrichtsbezug, aber z.B. auch die Chance, Gelerntes auf ein lebensnahes Phänomen anzuwenden, ein mögliches Thema für die 5. PK im Abitur vorzubereiten oder eine Studienarbeit im informationstechnischen Format zu erproben.
Zugelassen sind alle HCG-Schüler*innen der Oberstufe, unbeschadet dessen, ob sie Philosophie als Fach gewählt haben, und die 10. Klassen.
Bücherpreise für die drei besten Einsender*innen werden dankenswerterweise vom Förderverein gestiftet.
Ausschreibungstermin soll jedes Jahr der UNESCO-Welttag der Philosophie sein, zu dem 2002 der dritte Donnerstag im November erklärt wurde. Einsendeschluss ist immer der 12. Februar, Kants Todestag. Dieser Zeitraum hat für euch den Vorteil, dass er erstens die Weihnachtferien, meistens auch die Winterferien, einbezieht, und zweitens für die Abiturienten noch nicht zu spät liegt.
Die Bekanntgabe und Veröffentlichung des Gewinner*innen-Produkts soll am 22. April, Kants Geburtstag, erfolgen. Die Preise werden am letzten Schuljahrestag, für die Abiturient*innen auf der Abschlussfeier, überreicht werden.
Ausschreibung des Themas und Sichtung eingegangener Arbeiten liegt in meinen Händen, die Bewertung erfolgt einvernehmlich unter den Philosophie-Lehrern.
So, und hier ist nun eure Aufgabe für den 7. HCG-Philo-Wettbewerb 2017/18:
Schreibe eine philosophische Beantwortung der Frage: „Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?“
Erläuterung: Gefordert ist eine philosophische Reflexion über Werte, Schule und ihren Zusammenhang: Was sind überhaupt ethische Werte? Und in welcher Beziehung stehen sie zur Moral? Was ist Schule, primär eine staatliche Institution oder die Gemeinschaft von Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern? Welchen Werten sollte eine Schule verpflichtet sein? Wie ist die Hierarchie der verschiedenen Werte zu sehen: Welches sind die wichtigsten? Wie können sie durch Schulen auf den Weg gebracht werden? Müsste dies für verschiedene Schularten, verschiedene Länder und Orte unterschiedlich gesehen werden? Welche Rolle spielen dabei das Schulgesetz, das Schulprogramm, die Schulordnung, der Unterricht und der Schulname? Philosophisch wird euer Text dadurch, dass er die schulische Förderung von Werten in grundsätzlichen Gedanken, Argumenten oder Betrachtungen reflektiert, sie z.B. unter ethischen, anthropologischen, staats- und rechtsphilosophischen, sozialphilosophischen oder sprachphilosophischen Gesichtspunkten interpretiert.
Der Text soll maximal 4 Computer geschriebene Seiten umfassen. Schrift-Format: Times New Roman, Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig. Im Kopf der Arbeit sind der volle Name und die Jahrgangsstufe anzugeben; am Ende des Beitrags soll die Erklärung stehen: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. (Unterschrift)
Sende deinen Text bitte in einem Word- oder rtf-Format abgespeichert an: Muellermozart@hcog.de
Die Bewertungskriterien für deinen eingesandten Text sind:
1. Themenbezogenheit
2. Philosophisches (nicht fachwissenschaftliches) Verständnis des Themas
3. Argumentative Überzeugungskraft
4. Stimmigkeit und Folgerichtigkeit
5. Originalität
Und nun viel Spaß beim Nachdenken und Schreiben über die Frage „Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?“
Herzlicher Gruß,
Dr. Ulrich Müller (Fachleiter für Ethik/Philosophie)
Hier noch mal das Wichtigste in Kürze:
7. HCO-Philo-Wettbewerb 2017/18
Ausschreibung: Am 16.11.2017, dem UNESCO-Welttag der Philosophie (jeweils am 3. Donnerstag im Monat November)
Teilnahmeberechtigt: Die Oberstufe und alle 10. Klassen
Aufgabe: Das Schreiben eines philosophischen Beitrags zur Frage „Welche ethischen Werte sollten von einer Schule gefördert werden?“.
Format: Computer geschriebener Text; maximal 4 Seiten; Schriftart: Times New Roman in Größe 12, 3 Zentimeter Rand, einzeilig; im Kopf der Arbeit: Name und Jahrgangsstufe; am Ende des Textes die Erklärung: Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. (Unterschrift)
Einsendeschluss: Am 12.02.2018 (Kants Todestag)
Adresse: Muellermozart@hcog.de
Gewinner/in: Am 22.04.2018 (Kants Geburtstag)
Urkunden und Bücherpreise des Fördervereins für die drei besten Einsender*innen
„Was ist Schönheit?“
22.04.2017: Königsberg meldet Entscheidung!
1. Preis: Hannah Vehse (10. Klasse)
2. Preis: Claudia Begemann (4. Semester)
3. Preis: Martin Biehl (2. Semester)
Philos und seine Freunde, allen voran Herr Rußbült und die Philosophie-Lehrer*innen des HCG, gratulieren ganz herzlich!
Post A Comment
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.









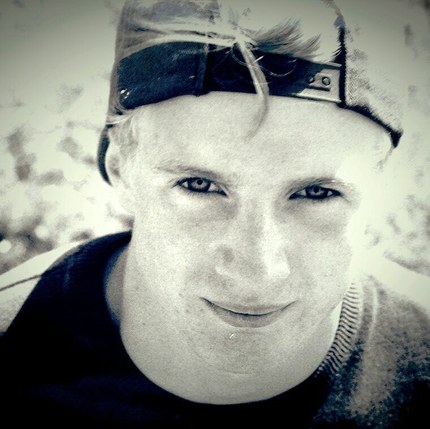
 Adorno, gezeichnet von Annika Erstling
Adorno, gezeichnet von Annika Erstling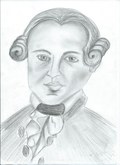 Kant, gezeichnet von Michelle Lorenz
Kant, gezeichnet von Michelle Lorenz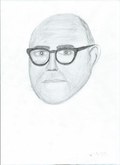 Adorno, gezeichnet von Vivian Kühn
Adorno, gezeichnet von Vivian Kühn
 Kant als Spaziergänger, gezeichnet von Paula Postel
Kant als Spaziergänger, gezeichnet von Paula Postel

 Kant, gezeichnet von Meike Kelpin
Kant, gezeichnet von Meike Kelpin Kant, gezeichnet von Kristian Shekhovtsov
Kant, gezeichnet von Kristian Shekhovtsov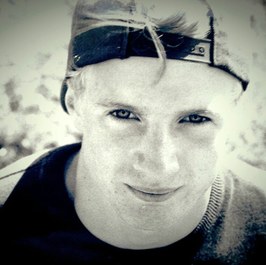



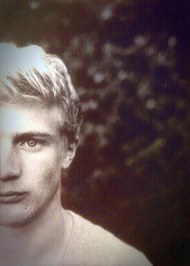

No Comments